Einstimmig angenommen vom Kongress der Revolutionären Kommunistischen Partei am 31.5.2025 in Bern. Als Word mit Grafiken runterladen.
«Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor.» Marx & Engels
Die alte Welt zerbricht vor unseren Augen. Trump hat der dahinsiechenden liberalen Weltordnung, die seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmte, den Todesstoss gegeben. Die Welt zerfällt in atemberaubendem Tempo in offen feindliche Blöcke. Wir befinden uns mitten in einer Periode des welthistorischen Umbruchs.
Verschärfung der Spannungen zwischen den Imperialisten, Handelskriege und Protektionismus, Aufrüstung und Kriege: Das alles sind Ausdrücke der Todeskrise des Kapitalismus. Die herrschende Kapitalistenklasse hat keine Lösung für die organische Krise ihres Systems, weil es innerhalb dieses Systems keine Lösung gibt. Der einzige Weg vorwärts für die Menschheit ist die sozialistische Revolution: der Sturz der Kapitalistenklasse, die Aufhebung des Privateigentums der Unternehmen und die rationale Planung der Wirtschaft durch die Machtergreifung der Arbeiterklasse.
Jede kapitalistische Kraft versucht, die Krise gewaltsam auf die Konkurrenz abzuwälzen. Den Preis für ihr rücksichtsloses Streben nach Machterhalt zahlen die Massen der Arbeiterklasse mit Armut, Inflation, Entlassungen, Sparmassnahmen, Kriegen und Zerstörung. Doch durch Jahre der Krise lernt die Arbeiterklasse. Der Unmut gegen den Status Quo steigert sich zunehmend bis hin zur Wut auf CEOs und die politischen Marionetten der Kapitalisten. Die Hammerschläge der aktuellen welthistorischen Ereignisse werden eine Schicht nach der anderen radikalisieren. Das bereitet den Boden für Revolutionen, nicht nur in den ärmsten Ländern, sondern im Herzen des Kapitalismus. Die USA und Europa stehen mitten im aufziehenden Sturm.
Das zentrale Problem unserer Epoche lässt sich einfach zusammenfassen: Es ist die Abwesenheit einer revolutionären Führung. Die Arbeiterklasse war in der Geschichte nie grösser und potenziell mächtiger als heute. Alle objektiven Voraussetzungen für eine höhere, klassenlose Gesellschaft wären vorhanden. Doch die Lösung der Krise der Menschheit bleibt durch die reformistische Degeneration der Arbeiterorganisationen blockiert. Es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der Kommunisten der Revolutionären Kommunistischen Internationale, heute die Grundlage für eine revolutionäre Führung auf der Höhe ihrer historischen Anforderungen zu schaffen.
Die Massen der Arbeiterklasse lernen aus ihren Erfahrungen. Kommunisten brauchen jedoch ein wissenschaftliches, marxistisches Verständnis. In diesen turbulenten Zeiten voller scharfen und schnellen Wendungen dürfen wir uns nicht von oberflächlichen Erscheinungen und den Stimmungsschwankungen der «öffentlichen Meinung» ablenken lassen. Wir müssen, ausgehend von einem Klassenverständnis, die grundlegenden Tendenzen in ihrer dialektischen Entwicklung verstehen. Nur das wird uns Orientierung, Standfestigkeit und Voraussicht geben. Einzig durch kontinuierliche und geduldige Arbeit auf der Grundlage der richtigen Einschätzung der Situation werden wir nachhaltig die kommunistischen Kräfte aufbauen können, um im Verlauf des revolutionären Prozesses die Massen fürs kommunistische Programm zu gewinnen.
Die Schweiz ist gänzlich Teil der internationalen Entwicklung. Sie war und ist noch eines der stabilsten Länder, gepolstert durch den angehäuften Reichtum aus ihrer imperialistischen Ausbeutung der Welt. Doch der Schweizer Kapitalismus zehrt von längst vergangenen Zeiten. Sein längerer Erfolg ist engstens verknüpft mit der Globalisierung und der liberalen Weltordnung, die sich in diesem Moment in unumkehrbarer Auflösung befinden.
Ziel und Anspruch dieses Perspektiven-Dokuments ist es, die allgemeinen, tieferen Tendenzen des historischen Prozesses herauszuarbeiten. Das kann selbstverständlich keine präzise Vorhersage der Zukunft sein. Es ist eine orientierende Arbeitshypothese für Kommunisten, die laufend konkretisiert und angepasst werden muss. Wir denken, dass wir in diesem Dokument unmissverständlich beweisen, dass die Schweiz dem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Wirbelsturm des Kapitalismus nicht entkommen kann. Wir leben in einer entscheidenden Phase der Menschheitsgeschichte. Wir müssen uns auf die Revolution vorbereiten.
Die Weltsituation erscheint komplett chaotisch. Sie wird leicht verständlich, wenn wir die tiefere Wurzel der Entwicklung verstehen: die Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise und der langgezogene Niedergang dieses Wirtschaftssystems.
Nach der Barbarei des Zweiten Weltkriegs konnte sich der Kapitalismus nochmal für eine ganze Periode stabilisieren. Die Weltwirtschaft sah einen nie gekannten Aufschwung. Das bildete in den reichsten imperialistischen Ländern die Basis für einen kontinuierlich steigenden Lebensstandard der Arbeiterklasse. Der Klassenkampf wurde gedämpft. Doch der Kapitalismus wird durch seine eigenen inneren Widersprüche untergraben. Im Kapitalismus sind Unternehmen im Privatbesitz. Gezwungen durch die Konkurrenz auf dem Markt, strebt jedes Unternehmen blind nach seinem Profit und muss die Produktion ausweiten, ohne Rücksicht darauf, dass die Absatzmärkte letztlich durch die Kaufkraft der in Armut gehaltenen Massen beschränkt werden. Das führt periodisch zu Überproduktionskrisen und zur zunehmenden Erschöpfung von Absatzmärkten und profitablen Investitionsmöglichkeiten.
Diese Widersprüche des Kapitalismus meldeten sich in den 1970er Jahren mit voller Wucht zurück. Die Weltwirtschaft stürzte in die erste globale Krise seit 1929. Seither versuchten die Kapitalisten ihre Profite durch drei Mechanismen zu retten: 1) Die Ausdehnung des Kredits (Verschuldung) zur Schaffung einer künstlichen Nachfrage; 2) Privatisierungen, Deregulierungen, Steuersenkungen, Sparmassnahmen und Angriffe auf die Löhne der Arbeiterklasse; 3) Am wichtigsten jedoch: durch einen gigantischen Schub der Globalisierung. Zölle und Handelsschranken wurden eliminiert, die Produktion teilweise in Billiglohnländer ausgelagert und in globale Wertschöpfungsketten integriert. Durch die Restauration des Kapitalismus in der ehemaligen UdSSR und in China in den 1990ern wurden zusätzlich riesige neue Märkte für die Profitsuche geöffnet. Über mehrere Jahrzehnte hat die Globalisierung die Lohnkosten tief gehalten und den Druck auf die Profite der Kapitalisten abgefedert. Doch im niedergehenden Kapitalismus ist jede «Lösung» temporär, oberflächlich und bereitet die Rückkehr der Krise auf höherer Stufe vor.
Die Weltwirtschaftskrise 2008 bildete den fundamentalen Wendepunkt in der jüngeren Geschichte des Kapitalismus. Die Ausweitung der Globalisierung kam zum Stillstand. Seither stagniert der Welthandel. Die ausländischen Direktinvestitionen sind nach ihrem Höhepunkt 2007 mittlerweile auf den tiefsten Stand seit 2003 gesunken. Die herrschende Kapitalistenklasse versuchte nach 2008, die Wirtschaft mit massiven staatlichen Rettungspaketen und billigem Geld anzukurbeln und die Konsequenzen durch Sparmassnahmen auf die Arbeiterklasse abzuwälzen. Trotz alledem schlitterten sie in ein volles Jahrzehnt der Quasi-Stagnation der Wirtschaft – und sitzen nun zusätzlich auf einem gigantischen Schuldenberg von 350 % des weltweiten BIP!
Der Grund ist simpel. Sie können die Grundursache der Krise nicht lösen: die globale Überproduktion. In jedem einzelnen wichtigen Sektor der Weltwirtschaft gibt es riesige Überkapazitäten. Praktisch der ganze Reichtum konzentriert sich bei einer winzigen Minderheit von Kapitalisten, die durch Monopole die gesamte Weltwirtschaft dominieren, während der Lebensstandard und damit die Konsumfähigkeit der breiten Massen gedrückt wird. Der Weltmarkt ist gesättigt und umfasst heute den ganzen Planeten. Er kann nicht mehr signifikant ausgeweitet werden. Es bleibt nur die imperialistische Neuaufteilung der Märkte unter den Konkurrenten.
Dieser Prozess hat in den letzten Jahren – mit der Covid-Pandemie 2020, dem imperialistischen Krieg in der Ukraine seit 2022 und nun mit der Trump-Präsidentschaft – eine qualitativ neue Stufe erreicht. All die jahrzehntelang angehäuften Widersprüche brechen gewaltsam auf und verstärken sich gegenseitig. Die Globalisierung steht nicht nur still, sie wird zurückgebaut: Lieferketten werden zerrüttet, die Produktion wird zurückverlagert. Der Protektionismus wird zur bestimmenden Tendenz. Die imperialistischen Blöcke befinden sich im Wirtschaftskrieg, in dem jeder versucht, die Profite der eigenen Industrie zu schützen – auf Kosten der anderen. Mit Trumps «America First»- und Zollpolitik eskaliert die Situation vollends. Es ist das definitive Ende der Epoche der Globalisierung, in der der Welthandel die wichtigste Stütze des Kapitalismus bildete.
Das Aufkommen des Protektionismus basiert nicht auf «dummen» Entscheidungen des Herrn Trump. Er ist nur der konsequenteste Ausdruck und Beschleuniger einer objektiven Tendenz, die sich schon länger anbahnte. Protektionismus ist das Resultat der Sackgasse des Kapitalismus und seiner Überproduktionskrise. Wenn es für die beschränkten Märkte zu viele Fabriken gibt, dann müssen irgendwo Fabriken geschlossen und Arbeiter entlassen werden. Jeder Nationalstaat vertritt die Interessen seiner Kapitalisten. Jeder will, dass der Kahlschlag bei der Konkurrenz im Ausland passiert, um nicht den Klassenkampf im Inland anzuheizen. Deshalb erheben sie Zölle auf ausländische Waren oder subventionieren heimische Unternehmen, um sie vor der ausländischen Konkurrenz zu schützen. Wenn jedoch ein Staat zu protektionistischen Massnahmen greift, muss auch die Konkurrenz reagieren, um nicht abgehängt zu werden. Das sehen wir jetzt überdeutlich: Die USA und China schaukeln sich im Handelskrieg gegenseitig hoch. Um den wegbrechenden US-Markt zu kompensieren, wird China versuchen, mehr Waren nach Europa zu exportieren – wogegen die EU sich wiederum mit Zöllen wird schützen müssen. So ziehen sich verschiedene Nationalstaaten – jeder im Versuch, den eigenen Niedergang auf Kosten der Konkurrenz abzubremsen – in eine Negativspirale. Sie wird die Inflation weiter nach oben treiben und riskiert, die ohnehin sehr fragile Weltwirtschaft in eine tiefe Depression zu stürzen.
Die Konsequenzen dieser Entwicklung betreffen nicht nur den Welthandel, sondern das gesamte Gefüge der Beziehungen zwischen den kapitalistischen Nationalstaaten. Seit Trumps zweitem Amtsantritt brechen jahrzehntealte Allianzen und Institutionen zusammen. Die Trump-Regierung hat binnen weniger Wochen die Weltordnung der letzten 80 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begraben.
Die USA waren seit dem Zweiten Weltkrieg die mit Abstand stärkste imperialistische Macht. Sie übernahmen vom niedergehenden britischen Imperialismus die Rolle als Weltpolizist und diktierten der kapitalistischen Welt ihre liberale «regelbasierte» Weltordnung: Verhüllt unter dem Schleier der «universellen Werte» von «liberaler Demokratie» und «Freiheit», beherrschte der US-Imperialismus die Welt durch seine multilateralen Institutionen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 blieb er als einzige Supermacht übrig und schien allmächtig.
Aber unter der Oberfläche steckt der US-Imperialismus schon länger im relativen Niedergang. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die USA 50 % des Welt-BIP aus, heute noch 26 %. Auf der anderen Seite ist China seit den 1990ern zur zweitwichtigsten Wirtschaftsmacht aufgestiegen und repräsentiert 17 % des Welt-BIP. Zwar sind die USA weiter die stärkste imperialistische Macht – und umgekehrt stösst der chinesische Aufstieg an seine eigenen kapitalistischen Schranken (Überproduktions- und Immobilienkrise). Doch das Kräfteverhältnis auf Weltebene hat sich verschoben. Das US-Imperium ist an seine Grenzen gestossen und ist nicht mehr fähig, seine Stellungen auf der ganzen Welt zu halten. Der Kampf zwischen den USA und China um die weltweite Vorherrschaft ist der bestimmende Konflikt der Epoche. Doch der Niedergang des US-Imperialismus hat ein Vakuum geöffnet, in das auch andere imperialistische Mächte (Russland, Iran, Türkei etc.) eintreten. Der Kampf zwischen den imperialistischen Mächten hat begonnen. Es ist der Kampf von Räubern um die Neuaufteilung der Welt, um Einflussgebiete, Ressourcen, Handelsrouten und militärische Stellungen.
Die demokratischen wie republikanischen US-Regierungen vor Trump, die traditionellen Vertreter des US-Imperialismus, haben den Niedergang des US-Imperialismus durch ihre unglaubliche Arroganz und Kurzsichtigkeit noch beschleunigt. Sie führten die USA in folgenschwere Niederlagen im Irak, Afghanistan, Syrien und nun in der Ukraine. Die monumentale Niederlage der NATO (des US-Imperialismus und Europas) in der Ukraine erweist sich als das Ende der Weltordnung, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestand: Es ist das Ende des Westens als Block.
Der US-Rückzug aus Europa ist vom Standpunkt des angeschlagenen US-Imperialismus nur die logische Schlussfolgerung. Trump bricht mit der Strategie des US-Imperialismus der letzten Jahrzehnte, die ihre materielle Basis verloren hat. Er leitet einen teilweisen Rückzug aus der ganzen Welt ein, mit dem Ziel, die Kräfte des US-Imperialismus in der «eigenen» Weltregion zu stärken, sie nicht durch weitere teure und aussichtslose Abenteuer zu schwächen – und so aus einer stärkeren Position gegen den Aufstieg Chinas zu kämpfen.
Es läuft eine geopolitische Neuordnung, die die Veränderung der Kräfteverhältnisse auf Weltebene widerspiegelt und beginnt, die Welt in besserer Übereinstimmung mit der relativen Stärke der imperialistischen Blöcke neu zu organisieren. Es ist eine Verschiebung von einer US-dominierten zu einer multipolaren Welt. Trump ist nur der Endpunkt einer jahrzehntelangen Entwicklung – und gleichzeitig der Startpunkt einer neuen Ära von grösster Instabilität und schnellen Wendungen.
Der Bruch des Bündnisses zwischen den USA und Europa ist die folgenreichste Verschiebung. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA Europa als klar untergebenen Bündnispartner gegen die Sowjetunion aufgebaut. Sie haben Europa zusammengehalten, finanziert und politisch, ökonomisch und kulturell gestützt als Teil ihrer liberalen «regelbasierten» Weltordnung. Aber die Interessen des US-Imperialismus decken sich nicht mehr mit jenen Europas. Trump zieht die Konsequenzen und opfert Europa.
Die Biden-Regierung hatte die EU in der Ukraine in den Krieg gedrängt. Die deutschen Kapitalisten hatten ihre Industrie auf den billigen Öl- und Gasimporten aus Russland aufgebaut. Für einen aussichtslosen Krieg haben sie die symbiotische Beziehung zu Russland und mit ihr die deutsche Industrie zerstört, um ihrem amerikanischen Herrchen zu gefallen – und jetzt kommt Trump, zieht sich aus dem verlorenen Krieg zurück, faltet den jahrzehntelang aufgespannten Schutzschirm zusammen und fordert von Europa, die Kosten für ihre Verteidigung künftig selbst zu zahlen! Trump zeigt dem alten Kontinent damit seinen wahren Platz im heutigen imperialistischen Weltsystem: Er ist bedeutungslos. Europa war die Wiege des Kapitalismus, das Zentrum aller imperialistischen Grossmächte des 19. Jahrhunderts. Nach Jahrzehnten des Niedergangs ist es heute der schwächste imperialistische Block, zerquetscht zwischen den USA, China und Russland.
Die Wirtschaftskrise in Europa betrifft nicht mehr «nur» die Peripherie-Länder. Sie ist im Herzen der EU angekommen. In Deutschland, dem industriellen Motor des Kontinents, ist die Industrie seit 2018 um 15 % eingebrochen. In der mächtigen Auto-, Metall-, Maschinen- und chemischen Industrie sind die Produktionskosten zu hoch, um in der globalen Überproduktionskrise konkurrenzfähig zu bleiben, erst recht seit der Krieg Europa vom russischen Gas abschnitt und die Energiekosten explodieren. Im Zentrum der Wirtschaftskrise steht die Autoindustrie, die in ganz Europa 14 Millionen Arbeiter beschäftigt und in Deutschland 6 % der Wirtschaft ausmacht. Unfähig, mit der E-Auto-Konkurrenz aus China mitzuhalten, schliessen die Kapitalisten bei VW und Co. Werke, entlassen massenweise Arbeiter und drücken die Löhne. Die Deindustrialisierung schreitet unaufhaltsam voran. In den entscheidenden Bereichen der technologischen Innovation, wo die USA und China um die Vorherrschaft ringen, ist Europa abgehängt (KI; Cleantech im Falle von China). Laut Ex-EZB-Chef Mario Draghi bräuchte die EU jährlich zusätzliche 750 – 800 Milliarden Euro an Investitionen (Erhöhung auf 27 % des BIP), um grössere Monopole zu schaffen, die im globalen Rennen mithalten könnten.
Doch die Kapitalisten investieren nicht, wenn es keine Profite gibt. Und die Staaten? Aber die EU ist keine Einheit. Sie ist ein Flickwerk von kleinen Nationalstaaten. Jeder einzelne Nationalstaat ist zu klein für solch grosse Investitionen. Aber keiner wird bereit sein, zusammenzulegen, um die Industrie in einem anderen Land aufzubauen. Jeder verfolgt die Interessen der eigenen Bourgeoisie. Das Gleiche auf militärischer Ebene. Jetzt ist Europa in ein dramatisches Wettrüsten eingestiegen. Die EU spuckt grosse Töne für eine gemeinsame «europäische Sicherheitsarchitektur», aber das ist eine reaktionäre Utopie. Sie haben ein 800 Milliarden Euro schweres Aufrüstungspaket beschlossen – auf Schulden! Das wird die Widersprüche nur verschärfen. Jeder Nationalstaat wird für sich schauen. Die EU konnte den Schein der Einheit wahren, solange die Wirtschaft einen relativen Aufschwung sah. In der Krise werden alle Einzelteile von den USA, China und Russland in verschiedene Richtungen gezogen.
All dies hat enorme soziale Folgen für den Kontinent. Die EU-Länder stecken schon am Rand von Budget- und Schuldenkrisen, noch bevor die neuen Militärausgaben obendrauf kommen. Die Arbeiterklasse wird für die Aufrüstung zahlen müssen durch den weiteren Rückbau des Sozialstaats. Das bereitet unausweichlich den Boden für massive politische Erschütterungen und Klassenkämpfe. Selbst der komplette Zusammenbruch der EU in den nächsten Jahren ist nicht ausgeschlossen.
Die internationale Situation und die Krise Europas werden eine tiefgreifende Wirkung auf die Schweiz haben. Die Schweiz kommt mit einem stärkeren Regime in die neue Situation als die meisten Länder. Aber revolutionäre Kommunisten müssen darauf vorbereitet sein, dass sich die Stabilität an einem gewissen Punkt relativ schnell in ihr Gegenteil verkehren kann. Das Ende der Globalisierung und der liberalen Weltordnung ist das Ende der Bedingungen, die der Schweiz über Jahrzehnte ermöglicht haben, den eigenen Niedergang zu verlangsamen. Um die Konsequenzen der neuen Weltsituation für die Schweiz zu begreifen, müssen wir verstehen, in welchem Zustand und mit welchem Profil der Schweizer Kapitalismus in die neue Periode eintritt. Dafür brauchen wir einen längeren Blick.
Die Schweiz ist ein kleines, reiches imperialistisches Land. Weil der Binnenmarkt sehr klein ist, richteten sich die Schweizer Kapitalisten früh international aus. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts waren der Finanzplatz (Banken und Versicherungen) und die hochspezialisierte, kapitalintensive Exportindustrie die Pfeiler des Schweizer Kapitalismus. Als «neutrales» Land konnte sich die Schweiz unversehrt durch die zwei Weltkriege mogeln. Das erlaubte dem Schweizer Kapital einerseits den Aufstieg des Finanzplatzes (geschützt durchs Bankgeheimnis karrten die Reichen ihre Aktenkoffer voller Geld in die Schweiz, um den Steuern zu entkommen). Andererseits stand die Schweiz am Kriegsende mit einem intakten Produktionsapparat da, während das restliche industrialisierte Europa zurückgeworfen und der Grossteil der Welt in kolonialer Unterentwicklung gehalten wurde.
So konnte das Schweizer Kapital aus einer Position der relativen Stärke von den aussergewöhnlichen Bedingungen der Nachkriegszeit (1945-1973) profitieren. Die Koexistenz zweier Supermächte, die sich im Kalten Krieg im Gleichgewicht hielten, eröffnete eine längere Periode des Friedens in Europa. Die USA spannten mit der NATO ihren militärischen Schutzschirm über Europa, von dem auch die Schweiz profitierte, ohne dafür zahlen zu müssen. Der US-finanzierte Wiederaufbau Europas schuf einen riesigen Absatzmarkt für die Schweiz. Die Industrie boomte und exportierte ihre Maschinen und chemischen Produkte nach Europa (insbesondere Deutschland, Frankreich, Italien), aber auch in die USA und die ganze Welt. Die Schweiz ordnete sich klar im westlichen Lager ein, konnte jedoch ihre Neutralität halten, auch wenn sie mehrmals von den USA unter Druck gesetzt wurde. Versteckt hinter der humanitären Fassade dieser Neutralität, machte die Schweizer Bourgeoisie Geschäfte mit der ganzen Welt, auch den vom westlichen Imperialismus sanktionierten Ländern (dem Ostblock, Apartheid-Südafrika etc.). Geschützt durch die Sonderstellung von Neutralität, Bankgeheimnis und der Tatsache, dass die meisten Länder ihre Finanzmärkte noch durch Kapitalverkehrskontrollen einschränkten, zogen die Schweizer Banken Gelder aus allen Weltregionen an. Diese investierten die Kapitalisten wiederum, um durch Überausbeutung ausländischer Arbeiter im Aus- und Inland Extraprofite einzustreichen. Diese Kombination von aussergewöhnlichen Faktoren ist die Grundlage der starken Stellung des kleinen Schweizer Imperialismus im globalen Kapitalismus, die auch eine hohe soziale und politische Stabilität ermöglichte. Die Schweiz zehrt bis heute von diesem Vorsprung aus der Nachkriegszeit.
Das Ende des Nachkriegsaufschwungs in den 1970ern leitete auch den Niedergang des Schweizer Kapitalismus ein. Der US-angetriebene Abbau von Zollschranken und die Liberalisierung der Finanzmärkte als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise verschärften die internationale Konkurrenz sowohl für die Exportindustrie wie für die Banken. Das Schweizer Kapital rettete sich – indem es die Krise 1975 und die Arbeitslosigkeit exportierte (Ausschaffung von über 300’000 Migranten) – noch bis in die 1990er Jahre, bevor die sinkende Wettbewerbsfähigkeit zum grösseren strukturellen Umbruch zwang: Kleinere Banken und Industrieunternehmen gingen ein oder fusionierten, das Kapital konzentrierte sich noch stärker in wenigen Grosskonzernen (UBS und CS bei den Banken; Novartis und Roche in der Pharma). Diese wurden damit stark genug, um auf den offenen Weltmärkten zu expandieren. Getrieben von der Pharma, explodierte der industrielle Export auf ein nie dagewesenes Niveau, während die Profite der Grossbanken und Versicherungen durch den spekulativen Boom auf dem US-Markt in die Höhe schossen. Durch das neu gegründete Freihandelsprojekt EU hatte der wichtigste Handelspartner der Schweiz eine neue, kurze Blüte. Die Schweiz erhielt durch die bilateralen Verträge Zugang zum europäischen Binnenmarkt und profitierte von der anziehenden Nachfrage der deutschen Industrie und der Ausweitung des Reservoirs an Arbeitskräften durch die Einführung der Personenfreizügigkeit. Dadurch erlebte der Schweizer Kapitalismus nach der 1990er-Krise einen Boom. Das Schweizer Kapital federte den eigenen Niedergang also dadurch ab, dass es umso stärker auf der Welle der Globalisierung ritt – die sich jetzt in ihr Gegenteil verkehrt.
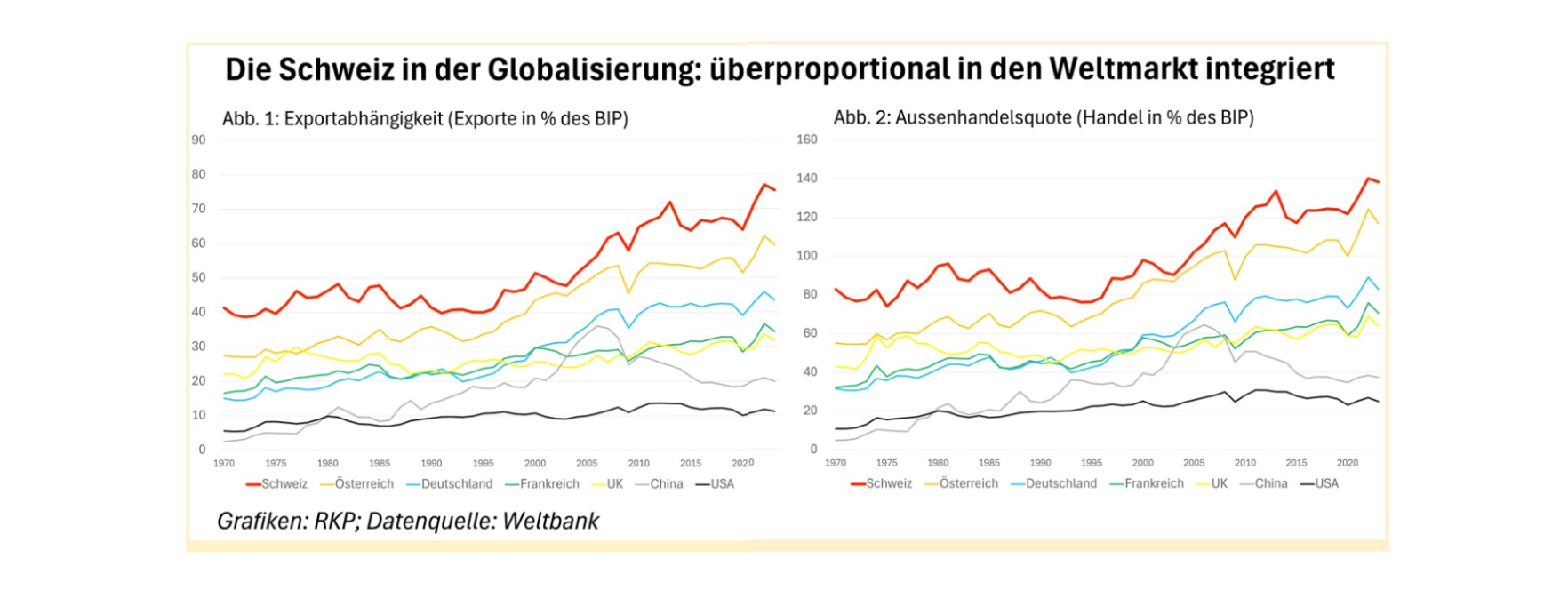
Die Weltwirtschaftskrise 2008 war auch für die Schweiz das Ende einer Epoche: die endgültige Rückkehr der organischen Krise des Kapitalismus. Symptomatisch für den ganzen Schweizer Kapitalismus wurde die UBS nach ihrem spekulativen Boom gewaltsam auf den Boden der Realität zurückgeholt: Sie crashte 2008 und musste vom Staat gerettet werden. Der US-Imperialismus ging in die Offensive gegen die Schweizer Konkurrenz und zwang sie zur Aufgabe ihres wichtigsten Standortvorteils: dem Bankgeheimnis. Die Schweizer Banken haben sich nie von dem harten Schlag erholt. 15 Jahre nach der UBS brach auch die CS zusammen. Ein zentraler Pfeiler des Schweizer Imperialismus wankt. Und der andere grosse Pfeiler, die Exportindustrie? Einerseits hat sie seit der Krise 2008 die Konzentration in jenen wenigen hochprofitablen Exportindustrien weiter vorangetrieben, in denen sie kaum in Konkurrenz durch billige Massenproduktion aus Ländern mit tieferen Löhnen steht. So profitiert die Pharma von Monopolpreisen durch Patente; die Uhrenindustrie von ihrer hochspezialisierten Nische im Luxus-Segment. Andererseits hat die Exportindustrie die Exportmärkte weiter «diversifiziert»: Sie hat stärker auf China gesetzt, das nach 2008 die wichtigste Stütze des globalen Kapitalismus war. Die Exporte nach China haben sich zwischen 2007 und 2015 mehr als verdoppelt. In den letzten Jahren wurden die USA, insbesondere wegen der Pharma, mit 18 % der Exporte zum wichtigsten einzelnen Exportzielland (mehr als Deutschland alleine; weniger als die EU insgesamt).
In welchem Zustand und mit welchem Profil tritt der Schweizer Kapitalismus also in die neue Weltsituation ein? Zum einen, wie wir sogleich tiefer erklären werden, in einem Zustand der Angeschlagenheit und Unterhöhlung durch den langen Niedergang der Schweiz als Teil der organischen Krise des Kapitalismus. Zum anderen mit einem Profil der Abhängigkeit von den Bedingungen, die heute wegbrechen: von offenen Weltmärkten, dem Frieden zwischen den Blöcken und einem starken Europa. In der ganzen Periode seit den 1990er-Jahren haben die Schweizer Kapitalisten versucht, sich dadurch vor der Krise zu retten, dass sie sich umso stärker in den Weltmarkt integrierten. Die Schweiz ist heute eines der am stärksten mit dem Weltmarkt verflechteten Länder (siehe Abbildungen 1 & 2 ). Jeder zweite Franken des Schweizer BIP wird im Ausland erwirtschaftet. Damit hat sich der Schweizer Kapitalismus verwundbar gemacht gegenüber Protektionismus und Blockbildung. Was in der Vergangenheit eine Stärke war, droht im Umfeld der heutigen geopolitischen Brüche zur grössten Schwäche zu werden.
Die Schweiz ist keine Insel. Sie ist Teil des allgemeinen Niedergangs des kapitalistischen Systems. Nach 2008 hat sich die Schweizer Wirtschaft schneller stabilisiert als andere Länder und konnte ihre relative Position gegenüber den meisten Konkurrenten halten. Aber sich im Verhältnis zu anderen halten, wenn alle niedergehen, ist schwerlich ein Grund zur Euphorie. Seit dem Wendepunkt 2008 verzeichnet die Schweizer Volkswirtschaft nur noch mickrige Wachstumszahlen um die 1 %. Doch selbst diese Zahlen verdecken den tieferen Prozess am Werk. In der Industrie sind es nach der Krise 2008 nur noch die pharmazeutische (+189 % seit 2011) und chemische Industrie (+67 %), die bedeutend wachsen – auf tieferer Stufe die Uhren und der Bau. Die restliche Industrie ist im Niedergang. Seit 2011 verloren die Sektoren Textilien (-27 %), elektrische Ausrüstungen (-11 %), Metallerzeugnisse (-12 %), Maschinen (-16 %). Die Pharma, angetrieben von den beiden Grosskonzernen Novartis und Roche, hat in den letzten drei Jahrzehnten ihre Wertschöpfung verdoppelt und macht mittlerweile die Hälfte der Industrie aus.
Der wichtigste Treiber hinter den ohnehin nicht rosigen Zahlen des Schweizer BIP ist der Rohstoffhandel. Die Schweiz ist eine Weltmacht im Transithandel mit Erdöl, Aluminium, Weizen und Kaffee. Dieser Sektor, der in engster Verbindung mit dem Finanzplatz steht, bläht die Zahlen des BIP auf. Doch hier wird überhaupt kein Wert geschaffen. Der Schweizer Rohstoffhandel ist vielmehr das Schmiermittel für die globalen Kapitalisten, wobei Teile des Mehrwerts aus der ganzen Welt abgezogen und zu Händlern und Finanzkapitalisten umverteilt werden. Während die Arbeiterklasse seit 2020 den Gürtel enger schnallen und für die Zerrüttung der Lieferketten und die Explosion der Energiepreise zahlen musste, verdienen sich die Parasiten in diesem Sektor dumm und dämlich.
Das zeigt, dass der Schweizer Kapitalismus unter der Oberfläche zunehmend hohl ist: Einziges wirkliches Zugpferd der Industrie ist die Pharma. Der Schweizer Kapitalismus ist abhängig von einer einzelnen Branche, die sich überdies in den letzten 10 Jahren stark auf den US-Markt ausgerichtet hat, weil der Medikamenten-Markt dort vollkommen liberalisiert ist und diese Räuber schamlos ihre hohen Monopolprofite einstreichen können. Sie sind nicht nur in der Schweiz entscheidend mitverantwortlich für hohe Gesundheitskosten, sondern ruinieren auch die US-Arbeiterklasse. Aber damit ist die Schweiz auch zusätzlich verwundbar gegenüber Trumps Zöllen.
Das ist nicht das einzige und nicht das offensichtlichste «Klumpenrisiko», mit dem die Schweiz in die neue Weltsituation tritt. Nach dem Zusammenbruch der CS und der Übernahme durch die UBS steht die Schweiz nun mit einer einzigen internationalen Grossbank da – die in ihrer Bilanz Gelder in der doppelten Höhe des Schweizer BIPs führt. Jeder weiss, diese Bank ist «too big to fail». Ein Crash würde das internationale Finanzsystem und die gesamte Schweizer Wirtschaft bedrohen. Sie müsste vom Staat gerettet werden. Doch sie ist auch «too big to save». Eine Rettung würde die Zahlungsfähigkeit der Schweiz übersteigen. Die Auslandsverschuldung der Schweiz würde explodieren und die Wirtschaft ruinieren. Wie schon nach dem UBS-Crash 2008 diskutieren Regierung, Politiker, Medien und «Wissenschaftler» jetzt über Regulierungen, um dieses «Risiko zu minimieren». Aber man kann Banken im Kapitalismus nicht sicher machen. Profite sind umgekehrt proportional zur Stabilität, das liegt in der Natur des Geschäfts des Finanzmarktes: Je höher das Risiko, desto höher die Profite. Dies gilt umso mehr in der Epoche des imperialistischen Niedergangs, wo die Kapitalisten mehr Gewinne machen können durch Spekulation als durch Investitionen in die Produktion. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zum nächsten Crash auf den chronisch instabilen Finanzmärkten kommt. Bei der engen Vernetzung der globalen Finanzmärkte birgt jeder Schock das Risiko, die UBS in den Abgrund zu reissen.
Um das enorme Risiko für den Schweizer Kapitalismus loszuwerden, müsste die UBS zerschlagen oder ins Ausland verkauft werden. Das wäre der endgültige Todesstoss für den stolzen Finanzplatz Schweiz. Das wäre langfristig zwar vom Standpunkt der herrschenden Klasse die rationalere Lösung für die soziale und politische Stabilität. Doch das ginge gegen das unmittelbare Interesse des mächtigen Finanzkapitals und käme dem freiwilligen, bewussten Abstieg des Schweizer Kapitalismus in die 2. Liga gleich. Der Bundesrat ist die Exekutive des Finanzkapitals, die Parlamentarier und bürgerlichen Parteien erhalten ihre Gelder und Instruktionen direkt aus den Banken. Sie machen nichts, was gegen die Interessen des Finanzkapitals geht. Falls leicht stärkere Regulierungen gesprochen werden, so nur zur Beruhigung der Arbeiterklasse. Und so versucht die Schweizer Bourgeoisie ihren Niedergang hinauszuzögern – nur um damit deutlich härtere Verwerfungen zu einem späteren Zeitpunkt vorzubereiten. Die Kapitalisten sind gefangen in den Widersprüchen ihres eigenen Systems.
Die Unterhöhlung des Schweizer Kapitalismus ist – wie in allen Volkswirtschaften in der organischen Krise des Kapitalismus – das Resultat des seit Jahrzehnten rückläufigen Wachstums der Investitionen in die Produktion. Produktive Investitionen sind der Motor des Kapitalismus. Sie sind, was dieser Produktionsweise seinen historisch progressiven Charakter und seine Daseinsberechtigung gab: Um in der Konkurrenz überleben zu können, reinvestieren die Kapitalisten einen Teil des Mehrwerts wieder in die Produktion und entwickeln die Technologie. Doch in der organischen Krise investieren die Kapitalisten kaum noch, weil die Märkte gesättigt sind. Der Niedergang des Schweizer Kapitalismus ist besonders deutlich (siehe Abbildung 4).
In den periodisch wiederkehrenden (d. h. «konjunkturellen») Krisen des Kapitalismus scheiden die unprofitablen, meist kleineren Unternehmen aus. Ein Teil des Marktes wird bereinigt. Das Kapital zentralisiert und konzentriert sich in den grösseren Unternehmen. Aber im Kapitalismus in seiner Phase des senilen Niedergangs stagnieren die Investitionen in jedem neuen Konjunkturzyklus auf tieferem Niveau als im vorherigen. Seit der Krise von 2008 sind die Investitionen zur tatsächlichen Erweiterung der Produktion auf dem historischen Tiefstand. Die Entwicklung der Produktivkräfte ist praktisch gänzlich erlahmt. Das zeigt überdeutlich, dass sich dieses historische System erschöpft hat. Wieso auch in die Produktion investieren, wenn die Märkte gesättigt sind? Lieber spekulieren die Kapitalisten auf den Finanzmärkten und zahlen sich von Jahr zu Jahr höhere Dividenden aus.
Mit sinkenden produktiven Investitionen sinkt notwendigerweise auch das Wachstum der Produktivität. Sie ist der Massstab für den Fortschritt eines historischen Systems und für die Konkurrenzfähigkeit innerhalb des Kapitalismus. In der Nachkriegszeit stand die Schweiz bezüglich Produktivität, zusammen mit den USA und mit einigem Abstand auf die übrigen europäischen Länder, an der Weltspitze. Zwar ist die Schweiz noch immer in führender Position, verliert aber seit Jahrzehnten an Vorsprung auf die Konkurrenz. Dass sich die Produktivität der Schweiz seit der 08-Krise wieder leicht besser (respektive: weniger schlecht) entwickelt, verdeckt auch hier: Das Produktivitätswachstum hat keine breite Verankerung in der Wirtschaft. Es kommt praktisch ausschliesslich aus der Pharma und Chemie und aus wenigen Grossunternehmen.
Die Schweizer Industrie war schon in der Krise – noch bevor Trump sein Amt angetreten, Zölle erhoben hat und die Folgen seines Wirtschaftskrieges gegen Europa voll durchschlagen. Die Schweiz verzeichnet bereits das zweite Jahr in Folge einen Rückgang im Wachstum des BIP pro Kopf (jeweils -0,2 %). In der Exportindustrie geht seit 2023 die Produktion zurück. Mit der Krise in Europa (insbesondere in Deutschland) und China sind wichtige Absatzmärkte gesättigt. Der Schweiz droht in den nächsten Jahren eine Welle der Deindustrialisierung.
Die Krise der Schweizer Stahlindustrie steht beispielhaft. Die Massenentlassungen bei den zwei letzten verbliebenen Stahlwerken der Schweiz (Stahl Gerlafingen und Swiss Steel in Emmenbrücke) zeigen die Wucht der grossen Tendenzen der Krise des Kapitalismus. Im weltweiten Kampf um Märkte und Profite wird die EU zwischen den USA und China zerrieben und mit ihr auch die kleine, exportabhängige Schweiz. Weltweit gibt es massive Überkapazitäten in der Stahlproduktion. China allein könnte 63 % der globalen Nachfrage decken. Die USA, China und die EU haben schon 2018 protektionistische Massnahmen ergriffen, um ihre eigene Stahlindustrie gegen die Konkurrenz zu schützen. Dazu kam die Explosion der Energiepreise mit dem Ukraine-Krieg. Die EU reagierte mit der Subventionierung eigener Stahlunternehmen. Mit Überproduktion, Subventionen bei der ausländischen Konkurrenz, hohen Strompreisen und dem Zusammenbruch des Absatzmarktes in Deutschland sind die beiden Schweizer Stahlwerke schlicht nicht international konkurrenzfähig.
Die MEM (Maschinen-, Elektro-, Metallindustrie) steckt in einer strukturellen Krise. Das ist der grösste Exportsektor, in dem mit 330’000 fast die Hälfte aller Arbeiter der Industrie arbeiten. Die Aufträge sind schon seit Mitte 2022 rückläufig, die Exporte sind 2024 um weitere -3,1 % eingebrochen. Das ist keine temporäre Situation: Durch die Überproduktionskrise schrumpfen die Absatzmärkte für die Schweizer MEM-Kapitalisten, die Investitionsgüter für andere Kapitalisten herstellen. 70 % ihrer Exporte gehen in die krisengeplagte EU, 23 % nach Deutschland. Nur noch 28 Prozent der MEM-Bosse glauben, dass es wieder besser werde. Besonders betroffen sind Zulieferer der niedergehenden deutschen Autoindustrie, die 32’000 Arbeiter beschäftigen.
Es ist die Arbeiterklasse, die für ihre Krise zahlt. Letztes Jahr sahen wir eine ganze Reihe von Schliessungen und Massenentlassungen in der gesamten Industrie. Die Stahlunternehmen in Gerlafingen und Emmenbrücke, der Glashersteller Vetropack, die Druckfabriken der Tamedia, die Maschinenbauunternehmen Rieter, die Lebensmittelindustrie (Micarna) und viele weitere haben Tausende Jobs vernichtet. Ein Drittel der KMU haben 2024 Stellen abgebaut. «Die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit steigt auf den höchsten Stand seit der Aufhebung der Euro-Kurs-Untergrenze», titelt die NZZ. Die Kurzarbeit (die Arbeiter arbeiten temporär nicht oder weniger und erhalten nur 80 % des Lohns) ist nur eine aufgeschobene Entlassung, insbesondere dort, wo die Probleme strukturell sind.
Die Schweiz steht in vielerlei Hinsicht noch an der Spitze. Viele hochspezialisierte Unternehmen bedienen spezifische Nischen. Wir sprechen nicht von einem Todesstoss der Schweizer Industrie auf einen Schlag. Aber ein Aufschwung und ein Zurück in die blühenden Zeiten der Vergangenheit ist ausgeschlossen. Die Schweiz ist mitten in einem Europa in der Krise. In der MEM-Industrie geht es an die wirkliche Substanz der Schweizer Industrie, wo die Leben von Zehntausenden Arbeiterfamilien und ganze Regionen betroffen sind. Eine Reihe von Unternehmen wird schliessen, industrielle Arbeitsplätze werden vernichtet oder ausgelagert werden – nicht weil die gut ausgebildeten Arbeiter mit ihrer Arbeitskraft und den technologisch hochstehenden Maschinen, die sie bedienen, nichts Sinnvolles für die Menschheit produzieren könnten. Sondern weil für die kapitalistischen Eigentümer die Märkte und damit Profite wegbrechen. Das ist die Absurdität des Kapitalismus in der Krise.
Innerhalb des allgemeinen Niedergangs des Kapitalismus steht die Schweiz noch immer weniger schlecht da als die meisten ihrer Konkurrenten. Sie hat nicht mehr den gleichen Vorsprung, liegt aber noch auf den Spitzenplätzen in der Wertschöpfung im Verhältnis zur Grösse der Bevölkerung (BIP pro Kopf). Doch die durchschnittlichen BIP-Wachstumszahlen von rund 5 % in den 50er und 60er liegen Jahrzehnte in der Vergangenheit und werden nicht zurückkommen. Die Schweiz konnte sich den Konsequenzen der Krise in der letzten Periode teilweise entziehen – doch musste sie dabei die Stützen ihres Erfolgs immer stärker angreifen.
Für die Schweizer Bourgeoisie gilt, was Marx für den gesamten Kapitalismus erklärte: Sie können die Widersprüche ihres eigenen Systems nicht lösen. Sie können sie überdecken, verschieben, hinauszögern, nur um dadurch neue Probleme, Risiken und Verwundbarkeiten zu schaffen, die ihnen an einem späteren Zeitpunkt umso härter ins Gesicht zurückschlagen. Die Krise des Kapitalismus hat die Schweizer Wirtschaft unterhöhlt. Und die Art und Weise, wie der Schweizer Kapitalismus seit den 1990er Jahren den eigenen Niedergang hinauszögerte – mit noch stärkerer Abhängigkeit vom Weltmarkt, mit der noch stärkeren Ausrichtung auf alle Blöcke – hat sie doppelt und dreifach verwundbar gemacht gegenüber genau jenen Entwicklungen, die in der neuen Weltsituation dominieren: die Umkehrung der Globalisierung, Protektionismus, Trumps Zölle, die Krise Europas und das Ende des Westens, die instabile multipolare Welt.
Das wird tiefe Konsequenzen haben für das angeschlagene und verwundbare «Erfolgsmodell Schweiz». Das muss nicht den Zusammenbruch der Schweizer Wirtschaft auf einen Schlag bedeuten. Aber Marxisten verstehen, dass sich die Situation mit all den hier aufgezeigten Widersprüchen an einem bestimmten Punkt schnell in ihr Gegenteil verkehren kann.
Die liberale Weltordnung der Nachkriegszeit bildete die Rahmenbedingungen, die es dem Schweizer Kapitalismus ermöglicht hatten, seinen eigenen Niedergang zu verlangsamen und länger Stabilität zu wahren. Die Schweiz profitierte von der Globalisierung, dem relativen Frieden zwischen den Blöcken und dem temporären Wiederaufschwung Europas. Diese Bedingungen sind dabei, wegzubrechen.
Da die Schweiz überproportional abhängig ist von offenen Märkten, ist sie überproportional gefährdet durch Handelskriege. Die Bank Goldman Sachs errechnet, dass nur die US-Nachbarländer Kanada und Mexiko, sowie Südkorea durch Trumps Zölle noch härter getroffen würden als die Schweiz. Die Schweiz steht auf Trumps Liste der «Dirty 15»-Länder, gegen die er wegen ihres Handelsüberschusses Zölle verhängen will. Anfang April kam der grosse Hammer: Im Rahmen seines Zoll-Rundumschlag gegen praktisch jedes Land der Welt verkündete Trump Zölle von 31 % gegen die Schweiz – mehr als gegen die EU! Auch wenn Trump die Einführung dieser Zölle kurz danach um 90 Tage aufschub, wurde überdeutlich: Die exportorientierte Schweiz ist an allen Ecken und Enden verwundbar.
Trump hat auch angekündigt, Importzölle auf Pharmazeutika in Betracht zu ziehen. Novartis macht 41 % und Roche 40 % ihres Umsatzes auf dem US-Markt. Goldman Sachs schätzt, dass das Schweizer BIP bei Verwirklichung der Drohung um 0,9 % tiefer ausfiele. Mit drohenden US-Zöllen gegen die Konkurrenz verkehrt sich die wichtigste Stütze der Schweizer Exportindustrie auf einen Schlag ins grösste Risiko! Die Grosskonzerne Roche, Novartis und Lonza erklären stolz, dass sie Zölle durch ihre Produktionsstätten in den USA teilweise umgehen könnten. Für die Arbeiter in den Werken in der Nordwestschweiz oder im Wallis und der kleineren Zulieferer ist das ein schwacher Trost, wenn ihre Arbeitsplätze in der Schweiz bedroht werden.
Wichtiger jedoch ist der sich abzeichnende Handelskrieg von Trump gegen die europäische Industrie. Die ohnehin stark angeschlagene MEM-Industrie ist in Panik. Wenn Trumps Zölle die Krise in der EU verschärfen, trifft das auch die Schweizer Industrie, deren Absatzmarkt weiter schrumpft. Diese «Zölle erhöhen den Druck auf die Zulieferer, noch günstiger zu produzieren – oder aus dem Geschäft zu fliegen», beklagt der Swissmem-Direktor. Im schlimmsten Fall gerät die Schweiz direkt zwischen die Fronten, indem die Zölle im Handelskrieg zwischen den USA und der EU gleich auf die Schweiz mit ausgeweitet werden.
Es ist unmöglich vorauszusehen, wie und in welcher Form sich die Handelskriege entwickeln werden. In jedem Fall ist die allgemeine Tendenz klar: Protektionismus und Blockbildung. Und in jedem Fall ist klar, dass die Schweiz von dieser Entwicklung überproportional getroffen werden wird und als kleines Land wenig entgegenzusetzen hat. Die Gefahren gehen dabei weit über einzelne Zölle hinaus. Mit einer Wirtschaft, die vom Handel mit allen Blöcken abhängt, ist die grösste Gefahr für den Schweizer Kapitalismus in der neuen multipolaren Welt, dass die grossen Blöcke ganz auseinanderbrechen – und die Schweiz gezwungen wird, sich zwischen der EU, den USA und China zu entscheiden. Auch wenn das nicht unmittelbar passieren wird, untergräbt jeder kleine Schlag in diese Richtung den Schweizer Kapitalismus weiter.
Während sich mit Trump die Tendenz zum Protektionismus weiter verschärft, versucht die Schweizer Bourgeoisie, solange es geht, gegen den Strom zu schwimmen und ihr Netz von bilateralen Freihandelsabkommen auszubauen. So gelang es ihr 2024, ein neues Freihandelsabkommen mit Indien abzuschliessen. Entgegen der westlichen Tendenz verhandelt sie auch mit China die Erneuerung des bestehenden Abkommens. Sie hofft, sich damit Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren westlichen Konkurrenten zu ergattern. Das kann temporär etwas Marge geben. Doch Absatzmärkte wie Indien oder Lateinamerika können die grossen, wirtschaftsstarken Blöcke nicht kompensieren. Im Falle von China besteht die ständige Gefahr, dass die USA oder die EU die Schweiz früher oder später zwingen werden, ihre Beziehungen mit China abzubrechen. Die Schweizer Bourgeoisie versucht, sich Zeit zu kaufen. Doch die allgemeine Entwicklung der Weltsituation arbeitet gegen den Schweizer Kapitalismus.
Die Schweizer Bourgeoisie hat sich traditionell hinter der «Neutralität» versteckt, um sich durch alle weltpolitischen Konflikte durchzumogeln und in der Position zu bleiben, mit allen Konfliktparteien gute Geschäfte zu machen. Wie gut ihr das gelang, war immer davon abhängig, wie viel Spielraum die Grossmächte der Schweiz dafür liessen. Dieser Spielraum wird enger. Die geopolitische Neuordnung – die multipolare Welt, die Krise der EU und des transatlantischen Bündnisses – ist die grösste Herausforderung für die Schweizer Bourgeoisie seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie zwingt ihr die unliebsame Frage auf, wie sich die Schweiz strategisch ausrichtet. Während politische und militärische Fragen in den Diskussionen in den Vordergrund gestellt werden, geht es im Kern letztlich um die Profite der Schweizer Kapitalisten.
Wir haben in den letzten Jahren stets betont: Die Schweizer Kapitalisten werden, solange es geht, versuchen, an China festzuhalten, das als aufsteigende Macht noch die am wenigsten düstere Zukunftsperspektive hat. Aber wenn es hart auf hart kommt, kann die Schweiz nicht anders, als sich im westlichen Block einzuordnen, mit dem sie historisch verwachsen ist und deutlich umfassendere, engere Beziehungen hat. Doch was ist jetzt? Dieser «Westen» bricht auseinander und die Schweiz liegt genau auf der sich öffnenden tektonischen Bruchlinie: zwischen zwei Fronten, zwischen denen sie nicht wählen möchte.
Auch wenn Trumps Handelskrieg diese Beziehung bedroht, ist für die Bourgeoisie völlig klar, dass sie auf gute Beziehungen mit den USA angewiesen ist. Die USA sind das wichtigste einzelne Exportland, sind dynamischer als Europa und sind weiterhin die tonangebende Weltmacht. Europa dagegen steckt in der tiefen Krise und ist das schwächste Glied in den imperialistischen Konflikten. Viele Schweizer Kapitalisten würden lieber auf die USA setzen – wenn da nicht die verflixte Tatsache wäre, dass die Schweiz mitten in Europa liegt und wirtschaftlich und militärisch komplett von der EU abhängig ist.
Mit dieser objektiven Position der Schweiz in der Welt gibt es für die hiesige herrschende Klasse keine gute Lösung, nur verschiedene schlechte. Nähert sie sich dem einen Handelspartner an, riskiert sie, Schläge durch den anderen einstecken zu müssen – und umgekehrt. Sie wird das versuchen, was sie immer getan hat: zwischen den Blöcken zu balancieren, zu lavieren und hinauszuzögern. Aber ständiges Lavieren provoziert bei jedem grösseren Konflikt, von denen es heute immer mehr gibt, intern und extern Reibungen. Das untergräbt die ökonomische und politische Stabilität.
Der Druck, der von der Weltsituation und den tektonischen Plattenverschiebungen in den internationalen Beziehungen auf die Schweiz wirkt, ist in den letzten Monaten mitten in der Landesregierung aufgebrochen. Das Verteidigungsdepartement (VBS) ist regelrecht implodiert. Verteidigungsministerin Amherd, Armeechef Süssli, Geheimdienstchef Dussey und weitere Ranghohe sind zurückgetreten. Die Spannungen im Bundesrat mit seiner ach so harmonischen Konsenskultur wurden offen an die Medien getragen.
Seit dem Krieg in der Ukraine ab 2022 stand die Schweiz unter dem Druck des NATO-Imperialismus, deren Sanktionen gegen Russland zu übernehmen. Der Bundesrat hatte damals kurz versucht, entgegenzuhalten und ist dann schnell eingeknickt. Er hat sich der westlichen Kriegspartei angeschlossen und russische Gelder in den Schweizer Banken eingefroren. In der Folge hat sich die Schweiz unter den Bundesräten Amherd und Cassis – unter dem Schlagwort einer «flexibleren Neutralität» – auch militärisch der NATO und EU angenähert. Die von der Schweiz organisierte Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock war ein Zirkus des westlichen Imperialismus – ohne Teilnahme der anderen Kriegspartei Russland. Es war deutlich, in welchem Lager sich die Schweiz einordnete. Unter Verteidigungsministerin Amherd beschloss der Bundesrat 2024, an zwei Militärprojekten der EU (Pesco) mitzumachen, dem europäischen Luftverteidigungsprojekt Sky Shield beizutreten und die Zusammenarbeit und gemeinsamen Übungen mit der NATO zu verstärken.
Doch sich für eine Seite zu entscheiden hat Konsequenzen. Durch die Sanktionen und die Annäherung an die NATO betrachtet Russland die Schweiz heute nicht mehr als neutral und möglichen Geschäftspartner, sondern als Teil des feindlichen Lagers. Die Schweiz hat damit den Reichen der Welt gezeigt, dass ihre Gelder auf dem Schweizer Finanzplatz nicht mehr sicher sind vor politischen Eingriffen. Ein Grossteil der russischen Gelder in den Schweizer Banken wurden mittlerweile abgezogen.
Umgekehrt ging die Annäherung und Unterordnung der EU und den USA nicht weit genug. Deutschland schloss Schweizer Unternehmen bei Beschaffungen der Bundeswehr aus, weil die Schweiz kein zuverlässiger Partner mehr sei. Die USA unter Biden setzten die Schweiz auf eine Liste mit Ländern, die nicht mehr uneingeschränkten Zugang zu KI-Chips bekommen, weil sie nicht vertrauenswürdig sind. Die Schweiz ist gefangen in objektiven Widersprüchen: Egal was sie macht, es ist falsch. Dabei war die Entscheidung zwischen dem Westen und Russland noch relativ einfach im Verhältnis zur Bruchlinie zwischen den USA und der EU, die sich jetzt auftut. Das führt zu zunehmend scharfen Auseinandersetzungen um die «Auslegung der Neutralität» und die strategische Ausrichtung der Schweiz.
Die SVP drückt auf einen isolationistischen Kurs der harten, «bewaffneten Neutralität» (die sie per Volksinitiative in die Verfassung verankern will). Sie schiesst seit 2022 gegen jede Annäherung an die NATO oder EU. Die Logik ist simpel: sich politisch aus allem raushalten, um auch weiter frei mit China oder Russland geschäften zu können. Mit dem Ende des transatlantischen Bündnisses wird diese isolationistische Position stärkeren Auftrieb bekommen, da sie konsequent versucht, nicht Seite zu beziehen. Nur: Die Schweiz hat wenig entgegenzusetzen, wenn eine Grossmacht ernsthaft Druck auf die Schweiz macht.
Die SP steht auf der polar entgegengesetzten Seite in diesem Richtungsstreit, der seinem Gehalt nach 100 % inner-bürgerlich ist. Die SP war die erste und lauteste Stimme in der Schweiz, sich im imperialistischen Krieg in der Ukraine der reaktionärsten Kraft auf dem Planeten anzuschliessen: der NATO unter Führung des US-Imperialismus. Fabian Molina, prominentester Aussenpolitiker der SP, ist auch der vehementeste Gegner des Freihandelsabkommens mit China – und jetzt seit Trump auch gegen eines mit den USA. Die Grundlage dieser SP-Position ist rein moralisch: «Wir im Westen» sind die Guten; Russland, China, Iran und jetzt Trump sind die Bösen; «Wir» sind für «Menschenrechte» und «Demokratie» gegen diese «Autokraten». Der wahre Inhalt hinter der Hülle solcher leeren Abstraktionen ist die Einfügung der Schweiz zuerst ins Lager des transatlantischen Imperialismus gegen Russland. Und jetzt, da Trump das transatlantische Bündnis zerschlägt, reihen sich Molina, Wermuth und Co. im Lager der Kriegstreiber der europäischen herrschenden Klassen ein, die für einen längst verlorenen Krieg weiter das Blut ukrainischer Soldaten opfern. Dass sie sich dessen nicht bewusst sind, macht die Sache nur erbärmlicher. Am allerwenigsten vertritt die SP damit die Interessen der Arbeiterklasse.
Mit weniger Hysterie vertritt die Mitte-Partei von inzwischen Ex-Bundesrätin Amherd die gleiche Linie wie die SP. Dass Amherd und ihr Stab kollabierten, ist Ausdruck davon, dass Teile der Bourgeoisie zum Schluss kamen, dass die Annäherung an die NATO und EU zu weit ging. Die SVP hatte schon lange Druck auf die Bundesrätin und Armeechef Süssli gemacht. Die FDP hatte zu Beginn des Ukraine-Kriegs die Unterordnung unter den transatlantischen Imperialismus mit vorangetrieben. Doch je offensichtlicher wurde, dass der NATO-Block international isoliert und innerlich zerrüttet ist, desto mehr versuchten Teile der FDP – angeführt von Bundesrätin Karin Keller-Sutter – zurück zu balancieren und die Schweiz wieder unabhängiger zu positionieren. Das ist – zusammen mit der Frage, wie die Aufrüstung finanziert werden soll – der Grund, warum sich die Spannungen im Bundesrat rund um das Verteidigungsministerium bis zum Eklat zugespitzt haben. Doch mit der Wahl von Pfister (ebenfalls Mitte) zum neuen Bundesrat ist kein Problem gelöst: neues Gesicht, gleiche Situation wie davor. Mit dem Bruch zwischen den USA und Europa drücken die Parlamentarier und Bundesräte von SP und Mitte – inklusive Pfister – noch stärker in die Richtung, dass die Schweiz sich in die «europäische Sicherheitsarchitektur» integrieren müsse – während die SVP von der anderen Seite auf Isolationismus drückt.
Die FDP verkörpert mustergültig die Notwendigkeit der Schweizer Bourgeoisie, zu lavieren, zu balancieren, zu zögern. Sie nähert sich der SVP an, versucht aber gleichzeitig trotzdem, die Türen für die militärische Kooperation mit der EU nicht zu verschliessen. Nachdem Trump und sein Vize Vance den Bruch des transatlantischen Bündnisses offen präsentierten, reagierte Keller-Sutter schnell mit dem Versuch, die Schweiz unabhängig zwischen den Blöcken zu positionieren. Das zeigte den Willen, den USA unter Trump zu zeigen, dass die Schweiz nicht Teil der EU ist. Doch sich beim US-Imperialismus anzubiedern, heisst Europa vor den Kopf zu stossen, mit dem die Schweiz gute Beziehungen braucht und mitten in Verhandlungen ist. Wie man es dreht und wendet, es gibt keine gute Lösung für die Schweizer Bourgeoisie.
Nach Jahrzehnten, in denen die westlichen Imperialisten versucht haben, ihre wahre Natur hinter dem Schleier von Frieden und Kooperation zu verstecken, sind wir in eine neue Periode von Militarismus und offener Kriegstreiberei eingetreten. Jeder einzelne kapitalistische Nationalstaat rüstet auf. Die Schweiz zieht mit.
Europa war der Trittbrettfahrer der NATO unter Führung des US-Imperialismus und konnte sich leisten, die Armeeausgaben zurückzufahren. Die Schweiz konnte als Trittbrettfahrer des Trittbrettfahrers mitprofitieren. Seit dem Fall der Sowjetunion sind die Militärausgaben von 1,4 % des BIP (16 % der Bundesausgaben) im Jahr 1990 auf 0,7 % (7 % des Bundeshaushalts) im Jahr 2023 gefallen. Die lange Ausnahmesituation mit der totalen US-Hegemonie auf Weltebene ist vorbei. Jetzt kommt die Trendwende: Im Herbst hat das Parlament die Erhöhung der Militärausgaben auf 1 % beschlossen (4 Mia. Franken zusätzlich pro Jahr).
Mit dem Ende der US-Hegemonie ist auch die Illusion verschwunden, ein Nationalstaat könne sich dauerhaft ohne eigene militärische Stärke behaupten. Entsprechend sieht sich die Schweizer Bourgeoisie – wie alle Imperialisten – gezwungen, ihre Interessen erneut auf eigene Faust militärisch abzusichern. Dass ausgeschlossen ist, dass sie dies jemals ernsthaft alleine tun kann, heisst nicht, dass sie es nicht dennoch versuchen muss. Mit der Aufrüstung reagiert die Schweizer Bourgeoisie auch – in vorauseilendem Gehorsam – auf den Druck ihrer Verbündeten, nicht als Schmarotzer dazustehen. So stimmt auch sie in die europäische Hysterie über die Bedrohung des Vaterlandes durch Russland ein, um die nationale Einheit heraufzubeschwören, aufzurüsten und vom Klassengegensatz im Innern abzulenken. Letztlich wird die Armee immer in erster Linie auf die Unterdrückung des Klassenkampfes im Inland ausgerichtet sein.
Ausnahmslos alle Parteien – skandalöserweise inklusive SP und Grüne – machen mit in ihrem Drängen auf eine «schlagkräftige Armee». Prinzipielle Opposition gegen die Aufrüstung gibt es keine. Sie streiten sich nur über zwei Fragen der Umsetzung. Erstens wiederum über die Positionierung in der neuen mulipolaren Welt: Mit welchem Block und in welchem Ausmass muss die Schweizer Armee international kooperieren? Zweitens öffnen sich innerhalb der Bourgeoisie erste Bruchlinien, wie die Aufrüstung finanziert werden soll. Das ist (nebst der oben erklärten Frage der EU/NATO-Annäherung) der zweite Grund für die Eskalation im Bundesrat. Amherd wollte die Schuldenbremse aushebeln, um die Aufrüstung zu finanzieren. Die SVP-FDP Bundesratsmehrheit dagegen war (noch) nicht bereit, die tiefe Staatsverschuldung zu opfern, die einen wichtigen Standortvorteil des Schweizer Kapitalismus bildet. Dass sich dies an einem gewissen Punkt schnell ändern kann, zeigt das Beispiel der CDU in Deutschland. Die tiefe Schuldenquote kann der Schweizer Bourgeoisie in der kommenden Periode temporär einen gewissen Spielraum gewähren.
In jedem Fall ist klar: Es ist die Arbeiterklasse, die für ihre Kriegstreiberei zahlen soll. Die Frage ist nur ob heute oder morgen. Die Sparmassnahmen von 5 Milliarden Franken, die der Bund im letzten Herbst beschloss, sind zu grossen Teilen Produkt ihrer Aufrüstungspläne. Für die Produktion von Schrottmetall zur Schaffung einer illusorischen «Verteidigungsfähigkeit» soll bei der AHV, im Gesundheitswesen, bei Kitas, Flüchtlingshilfe, der Bildung und ÖV gespart werden! Das wird einen wichtigen Einfluss auf das Bewusstsein der Arbeiterklasse haben.
Die Beziehungen der Schweiz zur EU bleiben für die Bourgeoisie die zugleich wichtigste wie schwierigste aussenpolitische Frage. Die Schweizer Bourgeoisie hatte es in den späten 1990er-Jahren durch eine aussergewöhnliche Verkettung von Umständen geschafft, mit der neu entstandenen EU äusserst vorteilhafte «bilaterale Verträge» auszuhandeln: Die Schweiz erhielt vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt (inklusive Arbeitsmarkt durch die Einführung der Personenfreizügigkeit), ohne dafür jedoch den Preis der politischen und rechtlichen Integration zahlen zu müssen. Dass die EU zu einem solchen Zugeständnis bereit war, ist Ausdruck ihres damaligen Optimismus: Die Sowjetunion war gefallen, die Globalisierung schritt voran, die EU schien im unaufhaltsamen Aufstieg. Diese Zeiten sind lange vorbei.
Nicht mehr bereit, die «Rosinenpickerei» zu akzeptieren, stellt die EU die Schweizer Bourgeoisie seit 2008 vor die Wahl: Entweder ihr integriert euch in einen übergeordneten Rechtsrahmen oder die Bilateralen laufen aus. Die laufenden Verhandlungen über die «Bilateralen III» sind nur der neuste Anlauf in fast permanenten Verhandlungen, die in den letzten 15 Jahren mehrmals gescheitert sind. Die Schweizer Bourgeoisie steckt im Dilemma: Sie kann nicht ohne die EU als ihren wichtigsten Handelspartner. Aber sie kann auch nicht mit der EU, ohne die staatliche Kontrolle über ihre Bedingungen der kapitalistischen Ausbeutung ein Stück weit abzutreten. Als Resultat dieses objektiven Widerspruchs, ist die Bourgeoisie in dieser Frage heute gespaltener als in jeder anderen. Die neue Weltsituation verschärft ihr Dilemma nur zusätzlich. Der Bundesrat wird von zwei Seiten her eingeklemmt: von der SVP und den Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften hatten den Bilateralen Verträgen 2002 zugestimmt. Die Einführung der Personenfreizügigkeit bedeutete die Abschaffung des reaktionären Saisonnierstatuts, das die Einwanderung durch Kontingente regelte. In einem faulen Deal (sie akzeptierten damit auch die reaktionären Asyl-und Einwanderungsbestimmungen für ausserhalb Europas) erhielten die Gewerkschaften dafür ein bedeutendes Zugeständnis für die Schweizer Arbeiterklasse: die Flankierenden Massnahmen zum Lohnschutz. Dadurch konnten sie das Netz von Gesamtarbeitsverträgen und damit Branchen-Mindestlöhnen in der Schweiz seither massiv ausweiten. Da die EU diesen Lohnschutz aufweichen will, ist der Gewerkschaftsbund korrekterweise so lange bereit, seine faktische Vetomacht gegen die Verträge zu nützen, wie der bestehende Lohnschutz nicht kompensiert oder gar ausgebaut wird.
Innerhalb der Bourgeoisie drängen der Bundesrat (wenn auch zunehmend zurückhaltend), die grossen Unternehmerverbände wie Economiesuisse oder Swissmem, NZZ und andere auf die Erneuerung der Verträge mit der EU. Sie wollen schlicht nicht riskieren, den Zugang zum wichtigsten Absatzmarkt zu verlieren und es sich in der aktuellen Situation mit dem wichtigsten Wirtschaftspartner zu verspielen. Grosse Konzerne, insbesondere die hochspezialisierte Pharma, sind auf die Personenfreizügigkeit angewiesen. Der Schweizer Arbeitsmarkt ist zu klein für solche Monopole. Sie brauchen den einfachen Zugang zum europäischen Reservoir von qualifizierten Arbeitskräften. Zweifellos wäre der Wegbruch der Bilateralen ein bedeutender Einschnitt für die angeschlagene Schweizer Wirtschaft.
Wenn die SVP am vehementesten und konsequentesten gegen die Bilateralen schiesst, dann bestimmt nicht, weil sie gegen den für die Bourgeoisie so essenziellen Zugang zum europäischen Binnenmarkt ist. Vielmehr ist sie erstens nicht bereit, sich für diesen Zugang politisch unterzuordnen. Sie ist gegen die dynamische Übernahme von EU-Recht und dagegen, dass der Europäische Gerichtshof in Streitfällen entscheidet (gegen «fremde Richter»). Verkleidet hinter abstrakten Worthülsen der «Verteidigung der Schweizer Demokratie», zeigt sich darin die wahre Natur des bürgerlichen Staates und seines Rechtssystems: Die SVP ist gegen jeden Teil-Verlust der Kontrolle über den eigenen Staat an andere Konkurrenz-Bourgeoisien – ein schönes Eingeständnis, dass Gerichte und Rechtsrahmen nicht neutral sind, sondern das Werkzeug der nationalen herrschenden Klasse!
Die SVP ist zweitens gegen die Personenfreizügigkeit. Mit der bevorstehenden Volksinitiative «gegen eine 10-Millionen-Schweiz» drückt sie mit einem zusätzlichen Hebel in diese Richtung. Sie schürt mit ihrer typischen rechtspopulistischen Demagogie Hass auf Ausländer, um von der Klassenfrage abzulenken und mit Sündenbockpolitk eine Wählerbasis zu gewinnen. Aber dahinter stecken auch handfeste Interessen der Bourgeoisie: Zum einen will sie die Gewerkschaften und ihr Netz der GAV, Mindestlöhne und Lohnkontrollen zurückzudrängen. Zum anderen will sie zurück zum Saisonnier-Statut: Die SVP ist nicht gegen ausländische Arbeitskräfte. Sie ist dafür, sie maximal zu entrechten, um sie noch besser ausbeuten zu können. Ausländische Arbeiter aus EU-Ländern (75 % der Migranten) sollen wieder «Gastarbeiter» sein, die man ganz einfach aus dem Land werfen kann, um die Arbeitslosigkeit abzufedern, falls ein wirtschaftlicher Einbruch das erfordert.
Die SVP war mit dieser Position bis vor wenigen Jahren innerhalb der Bourgeoisie noch fast isoliert. Mittlerweile verläuft die Spaltung mitten durch die herrschende Klasse. Auch die FDP ist gespalten. Verschiedene milliardenschwere Unternehmerkreise aus der Industrie und Finanzwirtschaft haben sich in den Organisationen Kompass und Autonomiesuisse zusammengeschlossen, um ebenfalls gegen die Bilateralen zu lobbyieren.
Die ganze Bourgeoisie braucht den Marktzugang und gute Beziehungen zur EU. Aber das gibt es heute nur noch mit einem Preis. Wie viel Abstriche ist sie dafür bereit, an die Gewerkschaften einerseits und die EU andererseits zu machen? Das ist der Kern des Streits zwischen den verschiedenen Lager der Kapitalistenklasse. Hier, wie in den anderen Fragen der Positionierung der Schweiz in der Welt, verschärft sich der Richtungsstreit im Kontext von Handelskrieg, Blockbildung, Bruch des westlichen Lagers und der Krise der EU. Beide Lager sehen sich bestätigt: «Jetzt erst recht!», poltern die verzweifelten Befürworter eines Abkommens mit der EU, die fürchten, dass die Schweiz als Drittstaat in Zukunft sogar von der EU selbst zur Zielscheibe von protektionistischen Schlägen werden könnte. «Jetzt erst recht nicht!», poltern die Gegner, die jede Bindung zum sinkenden EU-Schiff lockern wollen und gegenüber den USA jeden Eindruck verhindern wollen, die Schweiz hätte irgendetwas mit dieser EU am Hut. Beide Seiten haben recht und unrecht. Beide suchen vergebens einen Ausweg aus der hoffnungslosen Sackgasse des Schweizer Kapitalismus.
Mit dem Ende der liberalen Weltordnung bricht der Schweizer Bourgeoisie der Boden unter den Füssen weg. Der Schweizer Kapitalismus braucht Europa und die Welt, doch in dieser multipolaren Welt hat es zunehmend keinen Platz für einen «unabhängigen» Schweizer Kapitalismus, der von den Nischen aller Blöcke profitieren will. In all diesen Fragen zur Positionierung der Schweiz in der Welt nehmen die Spannungen in der Bourgeoisie und ihren Parteien zu. Wieso? Weil sie in objektiven Widersprüchen gefangen sind, für die es vom Standpunkt des Schweizer Kapitals keinen Ausweg gibt.
Für die Arbeiterklasse und Revolutionäre ist das keine schlechte Entwicklung. Lenin erklärte, dass Revolutionen «oben» beginnen: mit Rissen in der herrschenden Klasse und ihrem Staatsapparat. Der Bruch im Bundesrat rund um das VBS gibt uns einen ersten kleinen Vorgeschmack, was auf uns zukommen wird. Je tiefer die Bourgeoisie in die Sackgasse gerät, desto schärfer, giftiger und zunehmend verzweifelter werden sich diese Konflikte und Richtungsstreits innerhalb der Bourgeoisie ausdrücken.
Wir müssen um jeden Preis verhindern, uns dem einen oder anderen Flügel auf ihrem sinkenden kapitalistischen Schiff anzuhängen. Das sind Kämpfe innerhalb der Kapitalistenklasse, in denen die Arbeiterklasse nur verlieren kann. Aussenpolitik ist nur die Fortsetzung der Innenpolitik mit anderen Mitteln. Innenpolitik ist Klassenkampf. Die Arbeiterklasse und die Bourgeoisie haben entgegengesetzte Klasseninteressen. Tragischerweise ist ein proletarischer Klassenstandpunkt heute in all diesen Fragen zur Position der Schweiz in der Welt komplett abwesend. Die SP vertritt in diesen Fragen einen 100 % bürgerlichen Standpunkt – und obendrein den lächerlich realitätsfernsten von allen. Die Arbeiterklasse und ihre Organisationen brauchen eine eigene, von den bürgerlichen Interessen unabhängige Position.
Liberale Weltordnung oder Protektionismus? Aber es gibt kein Zurück zur liberalen Weltordnung. Sie hat die neue Situation von Protektionismus, Handelskriegen und imperialistischer Aufrüstung überhaupt vorbereitet. In den Handelskriegen zwischen den Kapitalisten, wie in all ihren Kriegen, hat die Arbeiterklasse nichts zu gewinnen. Es sind nicht unsere Kriege. Es sind ihre Kriege, um ihre Profite auf Kosten der Konkurrenz zu sichern. Die lauter werdenden Rufe nach Subventionen der heimischen Unternehmen «um Arbeitsplätze zu retten» sind die Rufe nach Geldern der Arbeiterklasse für die Rettung der Kapitalisten. Warum sollten die Arbeiter dafür zahlen, dass Kapitalisten weiter Profite machen können? Der einzige Weg zum Schutz von Arbeitsplätzen gegen Schliessungen und Massenentlassungen ist die Besetzung der Unternehmen und die Verstaatlichung der Unternehmen unter Arbeiterkontrolle.
Flexible oder harte Neutralität? Aber ihre Neutralität ist die Ordnung der Schweizer Imperialisten, bestmöglich die Arbeiter der ganzen Welt auszubeuten. Die «flexiblere Ausgestaltung» oder Abkehr von der Neutralität ist die Unterordnung unter andere kriegstreibende Imperialisten. Die einzigen Verbündeten der Schweizer Arbeiterklasse sind die Arbeiter dieser Welt im Kampf gegen den schweizerischen und jeden Imperialismus.
Militarisierung? Aber jeder Rappen in die Aufrüstung ist ein Rappen, der für die wahre «Sicherheit» der Arbeiterklasse fehlt: Für ein gutes Gesundheitssystem, für gute Löhne, Wohnraum, Bildung oder Kinderbetreuung. Wir brauchen keine Sicherheit vor «den bösen Russen». Wir brauchen Sicherheit vor unserer eigenen Bourgeoisie, die sich wie alle Kapitalisten an ein sterbendes System klammert und dafür bereit ist, mit den Risiken von Atomkriegen zu spielen. Unsere einzige Verteidigung und Sicherheit gegen Kriege ist der Sturz der Bourgeoisie in der Schweiz als Teil der revolutionären Bewegung der globalen Arbeiterklasse.
Mit oder ohne EU? Wir anerkennen und unterstützen, dass die Gewerkschaften eine Klassenposition zur Verteidigung des Lohnschutzes haben. Aber die Frage ist deutlich grösser als dieses Abkommen: Sind wir für oder gegen die EU? Aber diese EU war niemals ein «Friedensprojekt». Sie war immer ein imperialistisches Projekt: ein reaktionärer Versuch von zu klein gewordenen Nationalstaaten, dennoch eine Rolle in der imperialistischen Welt zu spielen. Dieses Europa ist das Europa der Profite und der Kriegstreiber. Der einzige Weg zu einer echten Einheit der Völker Europas, zu Frieden und Wohlstand auf dem ganzen Kontinent, ist durch die Überwindung des Kapitalismus und die Schaffung einer sozialistischen Föderation Europas.
Die gesamte aktuelle Krisenspirale ist das Produkt der Tatsache, dass der Kapitalismus an die Fesseln seiner eigenen Produktionsverhältnisse stösst: ans Privateigentum und den Nationalstaat. Der Kapitalismus bedeutete einen gigantischen Fortschritt in der Menschheitsgeschichte. Die bürgerlichen Revolutionen hatten einen modernen Nationalstaat geschaffen; das kapitalistische Privateigentum schuf die moderne Industrie und vereinte den ganzen Globus in einem einzigen Weltmarkt. Doch gleichzeitig stehen die Kapitalisten und die einzelnen Nationalstaaten weiter in einer Konkurrenz zueinander, die sich in der heutigen Phase des Niedergangs bis zum kriegerischen Gegensatz steigert. Statt die Menschheit weiter voranzubringen, droht der Kapitalismus, uns in der Barbarei von Krieg und Zerstörung zu versenken. So wie die nationalen bürgerlichen Revolutionen die lokalen Schranken des Feudalismus sprengten, muss die internationale proletarische Revolution heute die Schranken des Nationalstaats sprengen und das private Eigentum aufheben. Nur das wird ein neues Zeitalter des Fortschritts für die Menschheit eröffnen.
Der Marxismus lehrt, dass die ökonomischen Entwicklungen die Basis bilden, auf der sich der politische und ideologische Überbau erhebt. Der fundamentale Wendepunkt in der Weltsituation – aktuell insbesondere auf ökonomischer und geopolitischer Ebene – wird notwendigerweise einen fundamentalen Wendepunkt in der sozialen und politischen Lage in der Schweiz nach sich ziehen.
Die Schweiz ist zweifellos ein Land, das in den letzten Jahrzehnten und bis heute ein hohes Mass an sozialer Stabilität und wenig offene Klassenkämpfe verzeichnet. Die materielle Grundlage dafür lag in den Bedingungen des wirtschaftlichen Aufschwungs der Nachkriegszeit, die wir im ersten Teil analysiert haben. Der Verteilkampf zwischen Kapitalisten und Arbeitern konnte abgemildert werden, weil der Kuchen insgesamt grösser wurde. Das ist die Essenz der sozialen Nachkriegsordnung in der Schweiz. Sie erlaubte der herrschenden Klasse, sich und ihrem bürgerlichen Staat ein schönes soziales Mäntelchen überzuziehen.
Doch in gleicher Weise, wie die langgezogene organische Krise des Kapitalismus seit Jahrzehnten auch den Schweizer Kapitalismus unterhöhlt hat, hat sie auch den Wohlstand der Schweizer Arbeiter – also die Grundlage des sozialen Friedens – über Jahrzehnte untergraben. Die neue Weltsituation trifft auf eine Schweizer Arbeiterklasse, deren Polster seit langem zusammenschrumpft.
Die Periode, in die wir eingetreten sind, bedeutet den definitiven Bruch mit den Voraussetzungen für das «Erfolgsmodell» Schweiz. Wenn die Profite wegbrechen, wird jemand dafür zahlen müssen – und das ist im Kapitalismus die Arbeiterklasse. Die Schweizer Bourgeoisie ist den internationalen Entwicklungen ausgeliefert. Sie ist zu schwach, um anderen Ländern ihren Willen aufzuzwingen und zu versuchen, die Krise durch Protektionismus zu exportieren. Ihr werden zunehmend nur noch zwei Möglichkeiten bleiben, um ihre Profitbedingungen zu schützen: erstens durch Angriffe auf die Arbeiterklasse in der Schweiz. Zweitens durch die Staatsverschuldung – womit sie sich jedoch nur zusätzliche ökonomische Probleme schaffen wird, die sie mittelfristig zu umso härteren Angriffen auf die Arbeiterklasse zwingen wird.
Die Kapitalisten werden die Arbeiterklasse auf zwei Fronten angreifen: Auf Betriebsebene durch Entlassungen und Schliessungen sowie durch Druck auf die Löhne, insbesondere durch die Inflation. Auf politischer Ebene durch weitere Sparmassnahmen, Angriffe auf die Sozialwerke und auf das Rentenalter. Aber damit macht sich die Bourgeoisie einen mächtigen Feind und bereitet den Boden für den Klassenkampf von unten. Der Arbeiterklasse wird in den nächsten Jahren kein anderer Weg bleiben als der kollektive Kampf.
Die Bourgeoisie und ihre kleinbürgerlichen Ideologen an den Universitäten haben seit Jahrzehnten propagiert, die Arbeiterklasse sei ein Phänomen des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, das seinen Platz nur in den Geschichtsbüchern hätte. Doch die Arbeiterklasse war in der Schweiz und weltweit noch nie so gross und potenziell so stark.
In der Schweiz gibt es heute mehr als 4 Millionen aktive Arbeiter. Das sind 55 % der gesamten Bevölkerung über 15 Jahre. Entgegen dem Mythos umfasst die Arbeiterklasse nicht nur Industriearbeiter, sondern alle, die ihre Arbeitskraft für einen Lohn verkaufen müssen. Diese Arbeiter sind es, die den ganzen Reichtum im Kapitalismus schaffen und die Räder der Gesellschaft täglich am Laufen halten. Sie alleine sind dadurch in der Stellung, die kapitalistische Produktion zu blockieren. Wenn die Arbeiter streiken, steht alles still – auch die Profitmacherei der Kapitalisten. Diese Klasse alleine ist dadurch in der Stellung, die Kapitalisten in einer Revolution zu stürzen, sie zu enteignen und die Produktion demokratisch nach den Bedürfnissen der Menschen zu planen.
Diese Arbeiter sind – im Gegensatz zum Mythos des KMU-Landes – konzentriert in wenigen Grosskonzernen. Etwa 37 % aller Arbeiter (1.5 Millionen) arbeiten in 1800 Grossbetrieben mit mehr als 250 Arbeitern. Und fast 900’000 Arbeiter (ca. 22 %) arbeiten bei rund 330 Konzernen (0.05%) mit mehr als 1000 Arbeitern! Damit einher geht eine riesige, potenzielle kollektive Macht.
Zu diesen 4 Millionen aktiven Arbeitern kommen 2.3 Millionen inaktive hinzu: Arbeitslose, zukünftige Arbeiter in Ausbildung, ehemalige Arbeiter in Rente, Hausfrauen und -männer, Kranke und weitere. Die Arbeiterklasse in diesem umfassenden Sinn besteht in der Schweiz aus 6.3 Millionen Menschen. Das sind 84 % der gesamten Bevölkerung! Diese Klasse ist vielfältig, hat Monatslöhne von wenigen hundert bis 12 tausend Franken, arbeitet mal mehr mit Kopf oder Hand, hat unterschiedliche Alter, Nationalitäten, Geschlechter oder sexuelle Orientierungen – aber alle werden von der herrschenden Klasse zunehmend angegriffen und alle haben das gleiche grundlegende objektive Interesse: Ein gutes Leben mit einem Dach über dem Kopf, sichere Ernährung, guter Lohn oder Rente, gute Bildung, Gesundheit, genug Freizeit und gesunde zwischenmenschliche Beziehungen.
Dem gegenüber steht eine winzige Minderheit von etwa 1 % von Kapitalisten und Grundbesitzer, die von der Arbeit und Zinsen anderer leben. Während Arbeiter Mühe haben, um ans Ende des Monats zu kommen, besitzen sie rund die Hälfte des gesamten Vermögens der Schweiz! Das ist die winzige Minderheit, die heute die Gesellschaft beherrscht und bereit ist, die ganze Menschheit mit sich in den Abgrund zu reissen, um ihre Profite und ihre Macht zu retten.
Nie in der Geschichte stand das objektive Kräfteverhältnis der Klassen offensichtlicher zugunsten der Arbeiterklasse. Diese Klasse hat nicht das geringste Interesse an der Aufrechterhaltung des Kapitalismus und jedes Interesse am Aufbau einer neuen, freien, klassenlosen Gesellschaft. Zu Marx’ und Lenins Zeiten konnten die Kapitalisten versuchen, das Kleinbürgertum – damals die überwältigende Bevölkerungsmehrheit – gegen die Arbeiterklasse zu instrumentalisieren. Doch das Kleinbürgertum macht heute in der Schweiz gerade noch rund 10 % aus! Die sozialen Reserven der Reaktion sind so klein wie nie zuvor. Ohne dieses grundlegende Klassenverständnis sind wir heute komplett verloren: Die grossen gesellschaftlichen Entwicklungen vor unseren Augen bleiben unverständlich und der Ausweg aus der Krise bleibt unsichtbar.
Die objektive Stellung der Arbeiterklasse in der Gesellschaft heisst nicht, dass sich die Arbeiter unmittelbar auch subjektiv ihrer Klassenzugehörigkeit und historischen Aufgabe bewusst sind. Marx erklärte, dass «die herrschenden Ideen einer Gesellschaft stets die Ideen der herrschenden Klasse» sind. Aber Marx erklärte auch, dass «das gesellschaftliche Sein» das Bewusstsein bestimmt. Die Lebensbedingungen der Menschen prägen ihr Denken. Die Angriffe auf die Arbeiterklasse führen, in einem langen, widersprüchlichen Prozess, zur Loslösung der Arbeiterklasse von den bürgerlichen Ideen.
Die Schweizer Arbeiterklasse hat sich an den hohen Lebensstandard gewöhnt. Insbesondere in der Nachkriegszeit ging es nur aufwärts. Die Löhne der Arbeiter wurden in sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen regelmässig erhöht. Der Sozialstaat wurde durch Kompromisse im Parlament finanziert. Wer einen Schweizer Pass und einen Job hatte, konnte sich ein gutes Leben erhoffen, zumindest besser als jenes der eigenen Eltern. Das Klassenkampfniveau blieb über Jahrzehnte tief, die politische Stabilität hoch. Die Reallöhne stiegen von Jahr zu Jahr bedeutend und kontinuierlich. Eine Generation nach der anderen hatte mehr zum Leben als die nächste.
Seit der Rückkehr der organischen Krise des Kapitalismus ab den 1970ern hat sich der Wohlstandsfortschritt für die Schweizer Arbeiterklasse drastisch verlangsamt. Allerdings konnte die Schweiz von einer dickeren Speckschicht zehren. Seit der zweiten Hälfte der 2010er nach der Weltwirtschaftskrise ist der Fortschritt zum Stillstand gekommen. Die Speckschicht wird zunehmend abgetragen. Während das verfügbare Einkommen der Haushalte zwischen 2000 und 2014 noch um 20 % gestiegen war, stagnierte es seit 2015 bis zur Coronapandemie 2020. Besonders schmerzhaft sind die Krankenkassenprämien, die im Vergleich zu den Löhnen explodierten (siehe Abbildung 8 unten). Bei etwa 40 % der Haushalte blieb schon vor Corona am Ende des Monats nichts übrig. Beim einkommensschwächsten Fünftel überstiegen die Ausgaben das Einkommen.
Die Schweizer Arbeiterklasse trat in einem Zustand der Verwundbarkeit in die neue Etappe der organischen Krise. Dann kam 2020 der historische Bruch: Nicht nur geht es nicht mehr aufwärts, es geht abwärts. Die Rückkehr der Inflation trifft die gesamte Arbeiterklasse. 2021 – 23 sinken zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg drei Jahre in Folge die Reallöhne (siehe Abbildung 7 oben). Die Kapitalisten frohlocken, dass sie die Inflation seit 2024 unter Kontrolle hätten. Aber auch die aktuellen Preissteigerungen von 1.1 % sind noch Steigerungen, die sich zu drei Jahren gestiegener Preise addieren. Die leichten Lohnsteigerungen 2024 machen diese drei Jahre Reallohnverlust nicht wett, diese Kaufkraft ist verloren. Die Kapitalisten werden sie nicht freiwillig wiederherstellen, umso mehr in ihrer Situation der Krise. Sie müssen durch Kampfmassnahmen der Arbeiterklasse dazu gezwungen werden.
Am Arbeitsplatz steigt die Belastung seit Jahren und treibt die Burnout-Raten in die Höhe. Gleichzeitig sind die Arbeiterfamilien im Alltag mit einer Krise der Lebenskosten konfrontiert. Die Anzahl Personen, die Mühe haben, ihre explodierenden Krankenkassenrechnungen zu zahlen, ist auf rekordhohe 36 % gestiegen. Bei den tiefen Einkommen gehen mittlerweile 44,8 % des Haushaltsbudgets für die steigenden Mieten und Nebenkosten drauf! In den letzten drei Jahren verzeichneten die Caritas-Läden in jedem Jahr einen neuen Verkaufsrekord. Der Schweizer Preisüberwacher stellt fest, wie es einen Wandel im Inhalt der Zuschriften gibt: weg von «Details» hin zu «existenziellen Fragen». Auf dem anderen Pol des Klassengegensatzes ist das Vermögen der reichsten 0,9 % von 2005 – 2021 real um 146 % gestiegen! Allein dieses zusätzliche Vermögen wären schon 520 Franken mehr Lohn, Rente, Stipendien pro Monat für jede einzelne Person der gesamten Arbeiterklasse! Wie Marx erklärte: Im Kapitalismus bedingt die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol zugleich die Akkumulation von Elend und Arbeitsqual auf dem Gegenpol.
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen werden sich für die Arbeiterklasse nicht verbessern. Im Gegenteil. Protektionismus, Blockbildung und Aufrüstung werden die Inflation neu anheizen. Die Wirtschaftskrise wird Entlassungen bringen. Die fehlenden Investitionsmöglichkeiten in der Produktion wird die Immobilienspekulation und damit unsere Mieten weiter in die Höhe treiben. Gleichzeitig müssen die Kapitalisten für ihre Aufrüstung und «Konkurrenzfähigkeit» weiter unsere Sozialausgaben kürzen. Die «guten alten Zeiten» sind definitiv vorbei. Es wird härter und geht abwärts. Das hat schon jetzt einen starken Einfluss aufs Bewusstsein.
Die «Kluft zwischen Arm und Reich» wird mittlerweile von fast 60 % als die wichtigste Spaltung in der Gesellschaft verstanden. Das UBS-Sorgenbarometer 2024 stellt fest, dass die «Top-20-Sorgen der Schweizer Stimmberechtigten stark materialistisch geprägt» sind: «Die Sorge vor finanzieller Unsicherheit und erhöhten Lebenskosten, bedingt durch steigende Kosten, spiegelt sich in rund einem Drittel der Sorgen wider. Dazu zählen Krankenkassen, Altersvorsorge, erhöhte Wohnkosten, Inflation, neue Armut, Sicherung der Sozialwerke und Steuerbelastung.» Die Arbeiterklasse schaut ohne Hoffnung in die Zukunft.
Doch es sind nicht die blossen Existenzmittel, die das Bewusstsein bestimmen. Es ist die Kombination aus dem alltäglichen Kampf, den Hammerschlägen der Weltpolitik und der Angst vor Krieg und Klimakrise auf der einen Seite, bei gleichzeitig wachsendem Reichtum und Abgehobenheit der herrschenden Klasse auf der anderen Seite. Das Leben in der sich beschleunigenden Krisenspirale im Kapitalismus drückt die Kluft zwischen den eigenen Interessen als Arbeiter und der abgehobenen Politik für die kleine Elite zunehmend in die Köpfe der Massen.
Genau das hat sich 2024 an der Urne gezeigt. Bereits Ende 2021 hatte die Arbeiterklasse zum ersten Mal in der Geschichte eine Gewerkschaftsinitiative angenommen. 61 % stimmten für die Pflegeinitiative für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. 2024 nahm sie dann zum ersten Mal eine Gewerkschaftsinitiative zum Ausbau des Sozialstaates an: Die 13. AHV-Rente.
Über Jahrzehnte war es der Bourgeoisie immer gelungen, die Arbeiterklasse anzulügen, dass die Verbesserung ihrer eigenen Lebens- und Arbeitsbedingungen den Wohlstand der Schweiz untergraben und das «Erfolgsmodell Schweiz» ruinieren würden. Dass ihre Lügen-Maschinerie trotz Millionen-Kampagnen nicht mehr funktionierte, drückt den historischen Wendepunkt aus. Die NZZ musste verdutzt die Frage aufwerfen, «was in den vergangenen Jahren mit den Schweizerinnen und Schweizern passiert ist.» Was passiert ist, haben wir soeben gesehen: Seit Jahren der Krise des Kapitalismus stagnieren die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse. Seit 2020 trifft die Lebenskostenkrise sie direkt spürbar, während vor den Augen der gesamten Arbeiterklasse die Vermögen der Reichsten weiter explodieren, Pharma-Konzerne mit dem Leid der Menschen Milliarden einstreichen und die Casino-Kapitalisten der CS mit 259 Milliarden vom Staat gerettet werden. Solche Ereignisse verändern das Denken.
Breitere Schichten der Massen beginnen, das Vertrauen in die bürgerliche Ideologie und ihre Institutionen zu verlieren. 2024 war das Misstrauen in die Behörden zum ersten Mal seit Aufzeichnungen grösser als das Vertrauen. Nicht einmal ein Drittel (31 %) hat noch die Illusion, der Bundesrat würde die Interessen der Gesellschaft über jene von Grossunternehmen wie Banken stellen. Die Autoren des «Hoffnungsbarometers» der Uni St. Gallen schlussfolgern: «Viele Menschen trauen Politik und Wirtschaft eine grundlegende positive Wende kaum zu.» Der Tagesanzeiger beklagt: «Unser Parteiensystem droht in eine Repräsentationskrise zu schlittern. Fast drei Viertel sehen sich keiner Partei mehr verbunden, ein neuer Höchstwert». Das Vertrauen in politische Parteien (38 %) und Medien (40 %) ist für die bürgerlichen Eliten bedenklich tief. Jahrzehnte der Angriffe und Verschlechterungen der Lebensbedingungen, fehlende Zukunftsperspektiven, drohende Kriege und Klimakrise bei gleichzeitiger schamloser Bereicherung der Eliten führen zu wachsendem Unmut und Ablehnung des gesamten Status Quo.
Zu all dem kam seit Ende 2023 die Erfahrung mit dem Genozid in Palästina dazu: Während die Institutionen und Medien der herrschenden Klasse sich klar sichtbar auf die Seite des Unterdrückers Israels stellten, identifizierten und solidarisierten sich breitere Schichten (insbesondere die migrantischen) der Arbeiterklasse mit dem Leid der unterdrückten Palästinenser. Die offensichtlichen Lügen haben die Glaubwürdigkeit insbesondere der bürgerlichen Medien weiter untergraben.
Mit den kommenden Angriffen macht sich die herrschende Klasse zusätzlich unbeliebt. Die Arbeiterklasse will nicht bei unseren Sozialausgaben sparen, um ihre Armee aufzurüsten – das zeigen Umfragen überdeutlich. Eine bereits angeschlagene Regierung wird eine bereits verwundete Arbeiterklasse stärker angreifen für ein Projekt, worauf die Arbeiterklasse keine Lust hat. Diese Situation hat soziale Sprengkraft.
Mit der Verschärfung von Trumps Handelskrieg wird die Schweizer Bourgeoisie auch das nationalistische ideologische Bombardement auf die Arbeiterklasse verstärken müssen: «Wir sind die Schweizer, wir sind das Lager der Vernunft und der Offenheit gegen den Autoritarismus». Dies wird die nationale Einheit stärken, aber nur oberflächlich. Denn gleichzeitig wird die Bourgeoisie die Arbeiterklasse durch Inflation, Standortverlagerungen und Entlassungen zur Kasse bitten.
Die Bedingungen der glorreichen Nachkriegszeit sind definitiv vorbei und werden nie wiederkommen. Doch sie haben bis heute Spuren im Bewusstsein hinterlassen. Seit Jahrzehnten haben die grössten Teile der Schweizer Arbeiterklasse kaum gekämpft, seit Jahrzehnten wird die Politik den Experten vom Abstimmungssonntag überlassen. In keinem Land verdeckt der Mythos der demokratischen Mitbestimmung stärker den wahren Klassencharakter des Staates als in der Schweiz.
Die Arbeiterklasse wird durch ihre eigene Erfahrung lernen müssen, dass es für Verbesserungen nicht reichen wird, einen Stimmzettel ins Couvert zu stecken. Je bewusster sie ihre Interessen zum Ausdruck bringt, desto mehr gerät die bürgerliche Demokratie unter Druck: Volksentscheide wie die Pflegeinitiative, die 13. AHV oder kantonale Mindestlöhne werden sabotiert, verschleppt oder höchstens symbolisch umgesetzt. Wie Teile der Pflege heute, wird die Arbeiterklasse insgesamt erkennen müssen, dass ihre Interessen nicht durch den bürgerlichen Staat umgesetzt werden. Sie wird gezwungen sein, den Kampf in die eigenen Hände zu nehmen und durch kollektive Aktion ihre Macht als Produzentin des gesellschaftlichen Reichtums gegen die Herrschenden einzusetzen.
Der Schweizer Arbeiterklasse steht ein langer Weg in der Bewusstseinsentwicklung bevor, bis die Massen sich nicht nur ihren eigenen Interessen, sondern auch ihrer kollektiven Macht umfassend bewusst werden. Es wird Zeit und viele Erfahrungen brauchen, um die Traditionen des Klassenkampfs – gewerkschaftliche und politische Organisierung, Massendemonstrationen, Streik, Fabrikbesetzungen bis hin zum Generalstreik – nach Jahrzehnten des sozialen Friedens wieder neu zu lernen.
Dieser Lernprozess könnte erheblich verkürzt werden mit einer guten Führung. Doch die Arbeiterklasse ist komplett auf sich allein gestellt: Sie hat keine Partei, die dabei hilft, den Klassencharakter des Staates und die entgegengesetzten Interessen von Arbeiterklasse und Bourgeoisie zu verstehen. Keine Partei, die eine Alternative zur kapitalistischen Krise bietet und den Weg aufzeigt, wie die Arbeiterklasse selbst aktiv in den Klassenkampf eingreifen kann.
Mit oder ohne Führung, die Angriffe auf die Arbeiterklasse wird sie lehren, dass die Zeit des Klassenfriedens vorbei ist. Es ist die Zeit des Klassenkampfes. Die Arbeiterklasse kann nur auf ihre eigene Kraft zählen. Sie wird sich nur durch die kollektive Aktion im Klassenkampf im Betrieb und auf der Strasse wehren können. Ob sie will oder nicht, die Angriffe werden sie auf diesen Weg drängen – weil es schlicht keinen anderen Ausweg gibt.
Der Widerspruch ist gigantisch: Während der Kapitalismus in seiner tiefsten Sackgasse steckt und die Arbeiterklasse nach Antworten und einer Alternative lechzt, herrscht auf Massenebene eine komplette Abwesenheit von Organisationen und Parteien, die eine solche Alternative und einen Weg aus der Krise aufzeigen.
Die SP ist die traditionelle Partei der Schweizer Arbeiterklasse. Die Arbeiter hatten sie im 19. Jahrhundert gegründet, um den Klassenkampf gegen die Kapitalisten und für den Sozialismus zu organisieren. Doch ihre Führung war nie revolutionär. Sie akzeptieren den Kapitalismus – das Privateigentum der Unternehmen und den bürgerlichen Nationalstaat – als eisernes Naturgesetz und hoffen, innerhalb dieses Rahmens Reformen durchführen zu können, die das Leben der Arbeiterklasse im Kapitalismus etwas erträglicher machen. Statt die Arbeiter rund um ein sozialistisches Programm zu organisieren und ihnen ihre eigene aktive Rolle im Klassenkampf gegen die Kapitalisten klarzumachen, sagen sie den Arbeitern: Wählt uns einfach ins Parlament, dann machen wir den Rest – und versuchen dann auf dem Terrain des bürgerlichen Staates, dem Parlament und als Teil der Regierung, Deals mit den Bürgerlichen auszuhandeln.
Im Nachkriegsaufschwung waren die Kapitalisten bereit, den Arbeitern einen etwas grösseren Teil des erarbeiteten Werts zurückzugeben, um sich dafür Streiks und Mobilisierungen vom Leib zu halten. Aber mit der Rückkehr der Krise des Kapitalismus brach der Spielraum dafür weg. Im Gegenteil: Um in der internationalen Krise konkurrenzfähig zu bleiben, müssen sie die Arbeiterklasse angreifen. Der SP blieben nur zwei Optionen: Entweder organisiert sie die Arbeiterklasse im Kampf gegen die kapitalistische Krisenpolitik oder sie ist gezwungen, den Niedergang des Systems mitzuverwalten und die Angriffe auf die Arbeiter mitzutragen – um den Preis, sich dadurch bei den Arbeitermassen unbeliebt zu machen. Die SP hat den zweiten Weg gewählt. Das ist der Grund für den langen Niedergang der SP seit den 1970er Jahren. Die SP steht nicht in Opposition zur herrschenden Klasse, sondern versucht sich als deren «vernünftigster» Manager. So trifft der Unmut von breiten Teilen der Massen gegen alle etablierten Parteien auch die SP. Sie ist damit Teil des gleichen grundlegenden internationalen Prozesses, wo das politische «Zentrum» an Unterstützung verliert und die Sozialdemokratie zusammen mit dem ganzen Establishment verhasst ist.
Wir müssen den widersprüchlichen Charakter der SP verstehen. Einerseits hat die SP eine kleinbürgerliche Führung, die gänzlich in den kapitalistischen Staat integriert ist. Sie vertritt in praktisch allen Fragen liberal-bürgerliche Positionen. Nirgendwo ist dies deutlicher als in den grossen aussenpolitischen Fragen. Weit entfernt von einer Opposition zu Krieg, Militarismus und Imperialismus, stützt sie dieses barbarische Regime und gibt ihm ein soziales und humanitäres Gesicht. Das zieht den Hass der vordersten Schichten, insbesondere der Jugend auf sich (zum Beispiel in der Palästina-Frage). Andererseits ist und bleibt die SP die einzige grössere «Alternative» zu den bürgerlichen Parteien. Teile der Arbeiterklasse blicken deshalb weiter zur SP als Partei zur Verteidigung des Sozialstaates. Eine Reihe von regionalen Kleinparteien der «radikalen Linken» positionieren sich links von der SP. Insbesondere in der Romandie verfügen sie über eine gewisse Verankerung. Aber ihr Reformismus, ihre rein parlamentarische Praxis und ihr identitätspolitischer Ansatz führen dazu, dass sie sich qualitativ nicht von der SP abheben und daher von den arbeitenden Massen und der Jugend unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht als glaubwürdige Alternative zu zur SP gesehen werden.
Kommunisten müssen verstehen, dass es Zeit braucht, bis diese Teile lernen, dass die Klassenkollaborations-Methoden der SP nicht erlauben, sich gegen die Angriffe der Kapitalisten zu verteidigen. Das darf jedoch unseren Blick auf den Prozess nicht verdecken: Die völlige Abwesenheit jeglicher Antwort auf die Krise des Kapitalismus öffnet ein riesiges Vakuum in der Arbeiterklasse. Unmut und Klassenhass stauen sich an, ohne einen politischen Ausdruck zu finden. Der Reformismus ist nur eine relative Bremse im objektiven Prozess. Die Arbeiterklasse hat keinen anderen Weg, als früher oder später selbst in den Kampf gegen die Krise des Kapitalismus zu treten.
Die Arbeiterklasse hat wichtige Traditionen wie den Streik verlernt und hat heute nur Gewerkschaften, die in der Sozialpartnerschaft der Nachkriegszeit gefangen sind. Das hat einen bremsenden, demobilisierenden Effekt auf die Arbeiter.
Aber an einem gewissen Punkt hat sich zu viel angestaut. Viele Arbeiter wählen zuerst eine individuelle Lösung und suchen einen neuen Job. Aber ewig funktioniert das nicht, wenn der Druck in allen Branchen und Unternehmen steigt. Wenn auch zunächst nicht auf Massenebene, werden die Arbeiter in verschiedenen Bereichen und Betrieben gezwungen sein, sich im kollektiven Kampf gegen die Angriffe der Kapitalisten zu verteidigen. Das gilt erstens für den öffentlichen Sektor. Insbesondere die Pflege und die Bildung sind nach Jahren der Sparmassnahmen ein Pulverfass. Diese provozieren Frust und ein moralisches Dilemma bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die sich aufgrund fehlender Mittel nicht in der Lage sehen, ihre Arbeit richtig zu erledigen. Zusätzliche Sparmassnahmen werden auf eine – sowohl für die Beschäftigten als letztendlich auch für die Nutzer – zunehmend unhaltbare Situation obendrauf kommen. Die Streiks im letzten Jahr (Staatspersonal im Tessin, Lehrerstreik in Genf, Kantonsspital in Fribourg) zeigen die Richtung. Die Bedingungen sind überall die gleichen, auch in der Deutschschweiz. Es gilt zweitens für die Verteidigung der Jobs gegen Massenentlassungen und Schliessungen. Auch hier haben wir im letzten Jahr vereinzelte Beispiele gesehen. Die Wirtschaftskrise wird weitere Defensivkämpfe unausweichlich machen.
Je nach Region und Sektor sind die Gewerkschaften auch teilweise bereit, die Kämpfe aufzunehmen. Doch die reformistische sozialpartnerschaftliche Orientierung und die daraus folgenden organisatorischen Methoden der Gewerkschaftsführungen (Stellvertreterpolitik statt aktiver Organisierung der Arbeiter in Betriebsgruppen) sind in der heutigen Periode eine komplette Sackgasse. Bei den Massenentlassungen in der Stahlindustrie hat die UNIA erfolgreich die Arbeiter der Betriebe mobilisiert. Aber statt den Kampf gegen die Besitzer zu richten, forderten sie Subventionen vom bürgerlichen Staat für die Kapitalisten. Die Arbeiter werden auf die harte Tour lernen müssen: Ohne Kampf gegen die Kapitalisten können keine Arbeitsplätze gesichert werden! Wir haben auch den inspirierenden 7-Tage-Streik der Arbeiter bei Vetropack (VD) gegen die Schliessung der Glasfabrik gesehen. Doch die UNIA beschränkte sich auf die Forderung «Keine Entlassungen ohne Sozialplan». Der Kampf wurde verloren, die Fabrik geschlossen. Kommunisten müssen in solchen Fällen an den Streikposten verteidigen: Gegen Schliessungen bleibt der Arbeiterklasse nur die Besetzung der Fabrik und der Kampf für die Verstaatlichung des Unternehmens unter Arbeiterkontrolle.
In der heutigen Situation braucht es eine massive gewerkschaftliche Mobilisierungs- und Organisierungskampagne gegen alle Sparmassnahmen und gegen die Deindustrialisierung. Eine solche Kampagne kann nur auf den Methoden des harten Klassenkampfes mit einem sozialistischen Programm zur Verstaatlichung der zentralen Schalthebel der Wirtschaft basieren. Der Ausgangspunkt muss sein: Wir zahlen eure Krise nicht! Arbeiter und Kapitalisten haben unvereinbare Interessen. Die Kapitalisten können nicht ohne die Arbeiter. Aber die Arbeiter können problemlos ohne die Kapitalisten!
Die Arbeiter haben keine anderen Organisationen als die bestehenden Gewerkschaften. Mit dem Druck der Krise und den zunehmenden Erfahrungen der Arbeiter wird zwangsweise auch der Druck der Arbeiter auf die Gewerkschaftsführung zunehmen, mit der Sozialpartnerschaft zu brechen. Wir Kommunisten kämpfen für die Wiedereroberung der Gewerkschaften durch die Arbeiter, für den Bruch mit der Sozialpartnerschaft, Klassenkampfmethoden und ein sozialistisches Programm; für die Demokratisierung der Gewerkschaften und die Kontrolle des Apparats durch die Arbeiter. Aufkommende Arbeitskämpfe unterstützen wir nach unseren Kräften mit diesem Programm.
Dieses immense Vakuum auf der linken Seite öffnet den Raum für Rechtspopulisten und deren Scheinlösungen. Das ist der Grund, weshalb wir in der aktuellen Phase der Krise des Kapitalismus den Aufschwung von rechten Demagogen wie Trump, der AfD, Le Pen und anderen sehen. In der Schweiz spielt die SVP die gleiche Rolle, auch wenn ihr Aufstieg schon weiter zurückliegt.
Die SVP ist in den frühen 1990ern unter Blochers Führung von einer zweitrangigen Partei zur stärksten politischen Kraft aufgestiegen, weil sie sich als Fundamentalopposition zum ganzen Establishment und allen etablierten Parteien präsentierte. Blocher und die SVP schossen gegen den «Filz» einer politischen und wirtschaftlichen Elite in «Bundesbern», die sich nicht um das Wohl der «Büezer» und der einfachen Bevölkerung kümmerte. Das Erfolgsrezept bestand und besteht bis heute darin, dass sie den realen Unmut von Arbeitern und Kleinbürgern aufnehmen und Ausländer und andere Minderheiten zum Sündenbock für die Probleme des niedergehenden Kapitalismus machen: für die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, hohe Lebenskosten, fehlenden Wohnraum, überfüllte Züge und Schulklassen und die Stagnation des Wohlstandes ganz allgemein. Dass diese Anti-Establishment-Rhetorik und Sündenbockpolitik von rechts bei Teilen der Arbeiterklasse funktionieren kann, liegt einzig und alleine daran, dass es keine Arbeiterpartei in Opposition zu ihren gesamten kapitalistischen Institutionen gibt. Die Stärke der Rechten ist das Scheitern der Linken.
Mit dieser rassistischen, sexistischen Demagogie hat es die SVP geschafft, temporär und oberflächlich eine soziale Basis zu gewinnen für eine harte Politik im Interesse der kleinen Minderheit von Kapitalisten. Die SVP stützt sich gleichzeitig auf drei Klassen: 1) auf die Grosskapitalisten: die Milliardäre von der Zürcher Goldküste, die den Kurs der Partei bestimmen; 2) auf Kleinbürger und Bauern: der historischen Basis der Partei; 3) auf Arbeiter, die desillusioniert sind mit der Establishment-Politik und eine Alternative suchen. Bei den Arbeitern mit dem tiefsten Einkommen wählen 31 % die SVP, fast doppelt so viel wie die SP.
In der aktuellen Situation gibt es verschiedene Elemente, die der SVP kurzfristig neuen Auftrieb geben können. Auf der einen Seite braucht das Grosskapital eine aggressivere Partei, sowohl für ihre Angriffe auf die Arbeiterklasse im Innern wie zur Verteidigung ihrer Nischen im imperialistischen Konkurrenzkampf. Die Kapitalistenklasse ist eine winzige Minderheit und ihre Parteien und Institutionen verlieren das Vertrauen der Arbeiterklasse. Die Spaltung der Arbeiterklasse entlang von Nationalitäten, Geschlechter oder Sexualität ist ihr einziger Weg abzulenken vom Klassenkampf: Solange die Arbeiter sich gegenseitig die Schuld geben für ihre Probleme, richten sie sich nicht gegen die kleine Minderheit an der Spitze, die tatsächlich verantwortlich ist. Auf der anderen Seite steigt das Verlangen der Arbeiterklasse nach Antworten. Die SVP ist die einzige Partei, die nicht in die Ukraine-Kriegshysterie der Liberalen einstimmte. Sie präsentiert sich als letzte Verteidigerin des Erfolgsmodells der unabhängigen Schweiz. In Abwesenheit echter Antworten von links, werden bestimmte Schichten der Arbeiterklasse sich weiter der SVP zuwenden.
Aber dieser oberflächliche Auftrieb verdeckt das Wesentliche. Wir haben immer erklärt, dass der Klassenwiderspruch in der SVP früher oder später aufbrechen muss. Während die SVP an die Arbeiter appelliert, ist sie gleichzeitig der aggressivste Rammbock des Grosskapitals gegen diese Arbeiterklasse. Sie treibt die Angriffe auf den Sozialstaat, Sparmassnahmen und Privatisierungen voran. 2024 brachen in der SVP an allen vier Abstimmungssonntagen Differenzen auf: Wenn die Klassenfrage auf den Tisch kommt, stimmt die Arbeiterbasis gegen ihre arbeiterfeindliche Grosskapitalisten-Parteiführung. So bei der 13. AHV oder bei der BVG-Konterreform. Bei der BVG hat sogar die ganze Solothurner Kantonalsektion gegen die Parteilinie Position ergriffen. Auch in der Frage der Aufrüstung der Armee drücken die Klasseninteressen durch. Die Arbeiterbasis der SVP will lieber bei der Armee als bei den Renten sparen. Dieser Widerspruch wird sich in Zukunft weiter zuspitzen.
Das zeigt, dass ihre Arbeiterbasis mit einer korrekten Klassenposition von der SVP weggebrochen werden könnte. Diese Arbeiter sind nicht «dumm» oder von Natur aus rassistisch. Statt mit moralischer Überlegenheit auf die Arbeiter runterzuschauen, wie es die reformistische Linke tut, muss eine Arbeiterpartei den Scheinantworten echte Erklärungen und Lösungen entgegensetzen. Verantwortlich für die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, für Lohndruck, überfüllte Schulklassen, hohe Mieten und Inflation sind nicht Ausländer, es sind die Kapitalisten. Die Arbeiter schaffen den ganzen Reichtum der Gesellschaft, doch es sind die Banken und Grosskonzerne, die bestimmen – das versteht jeder SVP-Arbeiter. Die Verstaatlichung dieser Banken und Grosskonzerne würde ermöglichen, dass die Arbeiterklasse demokratisch bestimmt, was produziert wird. Das würde ermöglichen, genug Wohnraum, Transportmöglichkeiten, sichere Renten und gute Löhne für alle bereitzustellen – unabhängig von der Herkunft oder dem Geschlecht. Auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Klasseninteressen können die verschiedensten Schichten der Arbeiterklasse zusammengebracht werden gegen die Kapitalisten. Im gemeinsamen Kampf lernen die männlichen, weissen Arbeiter auch, dass sie Seite an Seite mit ausländischen Arbeitern, Frauen und Queers das gleiche Interesse teilen. Nur auf dieser Basis kann man gegen die spaltende Hetze dieser Demagogen kämpfen.
Die spalterische Sündenbock-Politik mag dem Unmut von Teilen der Arbeiterklasse temporär einen verzerrten Ausdruck geben können. Doch die objektive Lebensrealität der Arbeiterklasse ist stärker als jede Propaganda. Rassistische Hetze füllt keine Teller, verteidigt keine Arbeitsplätze, hebt nicht die Kaufkraft, schafft keinen Wohnraum. Genauso wie sich die Trump-Wähler enttäuscht von Trump abwenden werden, weil er seine Versprechen auf Verbesserung des Lebens nicht wird halten können, werden auch die Hoffnungen der SVP-Arbeiter von dieser Partei enttäuscht werden. Die SVP ist seit Jahren Teil des Bundesrats und der Regierungen auf allen Ebenen. Dass sie es dennoch schafft, sich noch immer als Alternative zu präsentieren, hat zwei Gründe. Erstens ermöglichen die Besonderheiten der direkten Demokratie und der Konkordanz im Bundesrat, dass sich die SVP aus der Verantwortung zieht und sich weiter als alleinige Opposition profiliert – obwohl sie genauso Teil des von ihr kritisierten «Filzes» der herrschenden Klasse ist! Aber dass dieses absurde Spiel funktionieren kann, liegt einzig daran, dass die SP die SVP nicht entblösst. Aber ewig kann das nicht funktionieren.
Vielmehr als einen «Aufschwung» der Rechten, sehen wir heute die Suche der Arbeiterklasse nach Antworten und nach einem Ausweg aus der Krise. In Abwesenheit einer proletarischen Führung nimmt dieser Prozess widersprüchliche, verzerrte Formen an. Was wir sehen ist nicht der Beginn einer Periode von schwarzer Reaktion und Faschismus durch die Stabilisierung der kapitalistischen Herrschaft gestützt aufs Militär. Wir sehen die Schwäche einer herrschenden Klasse, die nur eine winzige Minderheit ist und durch ihre kapitalistische Krisenpolitik das Vertrauen ihrer lohnabhängigen Untertanen verloren hat. Es ist eine Periode von Instabilität und Krise der bürgerlichen Herrschaft.
Ohne tieferes Verständnis dieser Entwicklungen mag es scheinen, als sei eine Revolution in der Schweiz unmöglich, als könne sich die Arbeiterklasse in der Schweiz niemals bewegen, als sei das politische Regime der Schweiz unveränderlich und ewig. Aber die dialektische Philosophie lehrt uns, dass jede Stabilität nur das Resultat eines temporären Gleichgewichts der darunter wirkenden Kräfte ist. Die dialektisch-materialistische Methode und das Klassenverständnis des Marxismus erlauben uns, die tieferen Prozesse unter der Oberfläche zu verstehen. Wir sehen, wie die Krise des Kapitalismus unausweichlich die Bedingungen für die Revolution schafft – auch in der Schweiz als Teil der globalen Entwicklung.
Lenin erklärte, dass eine revolutionäre Situation entsteht, wenn die Herrschenden oben nicht mehr weiter herrschen können wie bisher und die Massen unten nicht mehr weiter leben können wie bisher. Davon sind wir in der Schweiz noch ein gutes Stück entfernt, keine Frage. Doch der tiefere Prozess, der diese Situation vorbereitet, hat an beiden Polen des Klassengegensatzes begonnen und verstärkt sich wechselseitig.
Unten steigt der Unmut. Es gärt es in den Tiefen der Arbeiterklasse. Ein grundlegender Umschwung im Bewusstsein ist im Gange. Das Gefühl, dass in der Welt und in der Schweiz «etwas fundamental falsch läuft», ist weit verbreitet. Ein brennender Hass auf «alle da oben» staut sich an – auf Bosse, schleimige Politiker, abgehobene Bundesräte, lügende Medien. In Abwesenheit einer revolutionären Massenpartei und mit der bremsenden Rolle des Reformismus wird sich der Unmut länger unter der Oberfläche anstauen können, ohne einen klaren Ausdruck zu finden. Doch unter dem Druck des niedergehenden Kapitalismus läuft die Stimmung, verzerrt und widersprüchlich, aber doch unaufhaltsam auf die Ablehnung des gesamten Kapitalismus und seiner Institutionen. Die neue Situation, in die der Schweizer Kapitalismus eintritt, wird der Arbeiterklasse schlicht keine andere Wahl lassen, als früher oder später in den Kampf zu treten.
Oben bereiten die neue Weltsituation und die generelle Sackgasse des Schweizer Kapitalismus den Boden für eine Krise der bürgerlichen Herrschaft. Der Bundesrat – die Regierung der Klassenkollaboration mit allen wichtigen bürgerlichen Parteien und der SP – und die ganze Schweizer Demokratie stehen auf scheinbar felsenfestem Fundament. Aber die Bedingungen für ihre «Konkordanz» und ihre «Kompromisse» werden untergraben. Unter dem Druck der multipolaren Welt auf die Schweiz von aussen und dem Vertrauensverlust der Arbeiterklasse von unten werden sich die Spannungen, Kämpfe und gegenseitige Blockaden innerhalb der Bourgeoisie verschärfen. Die «Amherd-Krise» in Bundesrat ist ein klarer Vorbote. Die Regimekrise wird sich auch in der Schweiz unausweichlich zuspitzen. Sie wird an gewissen Punkten offen ausbrechen und scharfe, unvorhersehbare Wendungen provozieren, lange bevor sich die Massen in einer Revolution erheben werden. In die Nachbarländer schauen heisst in die Zukunft der Schweiz schauen.
Das sind erst Keime, doch sie werden sich entfalten und wachsen – aus dem einfachen Grund, dass es für den Schweizer Kapitalismus kein Zurück zu den Bedingungen gibt, in denen er seine ökonomische, soziale und politische Stabilität errichten konnte. Vielleicht werden sich die Widersprüche noch länger anstauen, bevor es scheinbar plötzlich zu einem Bruch und grösseren Verschiebungen kommt und die Situation sich verkehrt. Aber es gibt auch zahlreiche Faktoren, die die Krise in der Schweiz auf einen Schlag dramatisch beschleunigen können: Eine Weltwirtschaftskrise, eine Staatsschuldenkrise, Finanzkrise, revolutionäre Massenbewegungen in Nachbarländern, weitere Kriege, der Kollaps der EU oder die Laune von Donald Trump.
Die Aufgabe von Marxisten ist nicht, ein Datum zu setzen oder die Form von solchen Wendepunkten vorherzusagen. Wir müssen ihre Notwendigkeit verstehen und dann mitverfolgen, wie sich die Prozesse konkret entfalten. Heben wir den Blick aus dem Alltag auf den grossen Geschichtsprozess, so sagen wir mit Rosa Luxemburg: Ihre Ordnung ist auf Sand gebaut! In den nächsten 10, 20, 30 Jahren wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Wir befinden uns in der Periode der Vorbereitung auf die Revolution in der Schweiz als Teil der Weltrevolution.
«Die Klasse an sich ist nur Ausbeutungsmaterial. Die selbständige Rolle des Proletariats beginnt dort, wo es aus einer sozialen Klasse an sich zu einer politischen Klasse für sich wird. Das vollzieht sich nicht anders als durch Vermittlung der Partei. (…) Der Weg der Klasse zum Selbstbewusstsein, d.h. die Herausbildung einer revolutionären Partei, die das Proletariat hinter sich herführt, ist ein verwickelter und widerspruchsvoller Prozess. Die Klasse ist nicht homogen. Ihre verschiedenen Teile kommen auf verschiedenen Wegen und zu verschiedenen Zeitpunkten zu Bewusstsein.»
Es ist nicht die Propaganda von Kommunisten, die Revolutionen provoziert. Es sind die objektiven Widersprüche und die Sackgasse des Kapitalismus, die die Massen in den Kampf und schliesslich zur revolutionären Erhebung zwingen werden. Doch die gesamte Geschichte des Klassenkampfes im Kapitalismus zeigt, dass dies für die siegreiche proletarische Machtergreifung nicht reicht. Die Arbeiterklasse braucht eine revolutionäre Partei, die die spontane Bewegung der Massen mit dem Programm, der Voraussicht, Strategie und Taktik des Marxismus zusammenführen kann.
Trotzt der dramatischen Dringlichkeit der Weltsituation, bleibt der Weg zur proletarischen Machtergreifung heute blockiert durch die komplette Degeneration der traditionellen Parteien der Arbeiterklasse. Wir Kommunisten haben uns zur Aufgabe gesetzt, die fehlende revolutionäre Partei aufzubauen. Die strategische Aufgabe unserer Generation ist es, Zehntausende von Arbeitern und Jugendlichen in einer kommunistischen Partei zu organisieren, die die Massen gewinnen und sie als Teil der internationalen revolutionären Bewegung zum Sturz des Kapitalismus führen kann.
Doch egal wie stark unser Wille und unsere Tatkraft sind, können die Kommunisten die Abwesenheit der revolutionären Führung nicht auf die Schnelle kompensieren. Die Todeskrise des Kapitalismus wird sich deshalb über die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinziehen. Diese Verzögerung in der revolutionären Lösung der Krise der Menschheit bedeutet nicht friedliche Stabilität. Sie bedeutet eine Krisenspirale, die sich gerade erheblich beschleunigt und scheinbar alles und jeden Bereich der Gesellschaft in sich saugt. So tragisch die Konsequenzen davon für die Menschen sind, ist es gleichzeitig auch das, was immer neue Schichten radikalisiert und dem authentischen Kommunismus nach den Ideen von Marx, Engels, Lenin und Trotzki zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Möglichkeit eröffnet, zu einer Massenkraft zu werden.
Die breiten Massen der Arbeiterklasse lernen nicht aus Büchern. Sie lernen durch ihre Erfahrungen im Leben und insbesondere im Kampf für bessere Lebensbedingungen. Dieser grosse Lernprozess hat begonnen. Die globale Arbeiterklasse sucht seit Jahren einen Ausweg aus der Krise.
In der ersten Phase nach der Weltwirtschaftskrise 2008 haben wir die Arabische Revolution 2011 gesehen, die globale Occupy-Wallstreet-Bewegung gegen die Banken, die 15M-Bewegung in Spanien und die vorrevolutionäre Situation in Griechenland. Wir haben den spektakulären Aufstieg und ebenso spektakulären Fall der neuen linksreformistischen «Anti-Establishment»-Parteien und Figuren Podemos, Syriza, Corbyn, Sanders gesehen. Dann eine neue Welle von teils insurrektionellen Massenbewegungen weltweit: die vorrevolutionäre Situation in Katalonien, die Gelbwestenbewegung in Frankreich, die gescheiterten Revolutionen 2019 in Chile, Ecuador, Sudan, Libanon. Nach der Covid-Pandemie die BLM-Massenbewegung und die Streikwelle gegen Inflation 2022 in den USA, die gescheiterten Revolutionen in Sri Lanka und Bangladesch – und jetzt erhebt sich die griechische Arbeiterklasse erneut auf höherer Stufe.
In der Schweiz läuft der gleiche Prozess, wenn auch nicht mit der gleichen Schärfe und Tiefe. In der ersten Phase nach der 2008-Krise wurde die JUSO mit der 1:12-Initiative und ihrer konfrontativen linksreformistischen «Anti-Establishment»-Politik zur Hoffnung einer sich neu radikalisierten Schicht der Jugend. Ab 2014 kam eine Reihe von Demonstrationen, Schülerbewegungen und Streiks gegen die Sparmassnahmen. Sie blieben noch kantonal zerstückelt. 2019 erreichte der Prozess in zwei nationalen Massenbewegungen eine neue Stufe: Am 14. Juni gingen eine halbe Million Menschen gegen Frauenunterdrückung und über Monate jeweils Zehntausende gegen die Klimakrise auf die Strasse. Breite Schichten der Frauen und der Jugend haben erste Praxis-Erfahrungen als aktiver Teil einer Massenbewegung gemacht.
Aber trotz der inspirierenden Kraft und Entschlossenheit der kämpfenden Massen sind all diese Bewegungen gescheitert, weil die reformistischen Führungen keinen Plan und letztlich keinen Mut hatten, mit dem Kapitalismus zu brechen.
Die Arbeiterklasse ist nicht homogen. Sie hat verschiedenste Schichten, die sich unterschiedlich schnell bewegen und nicht alle gleichzeitig Schlussfolgerungen aus ihren Erfahrungen ziehen. Unter dem Eindruck der grossen Ereignisse und den immer härteren Lebensbedingungen gärt es in den breitesten Schichten der Arbeiterklasse. Unmut und Hass auf die herrschende Elite waren seit Jahrzehnten nie verbreiteter und tiefer als heute.
Doch innerhalb dieses allgemeinen Prozesses hat in den Jahren nach 2020 ein qualitativer Sprung stattgefunden. Eine besondere Schicht ist entstanden, die radikalere Schlussfolgerungen gezogen hat und offen Richtung Kommunismus geht. Die Jugend – junge Arbeiter, Schüler, Studis und insbesondere junge Frauen – steht an der Vorfront dieses Prozesses. Eine Umfrage aus dem Vereinigten Königreich zeigt, dass 47 % der Gen Z findet, dass «die gesamte Art, wie die Gesellschaft organisiert ist, durch eine Revolution radikal verändert werden muss». 29 % sagen, der «Kommunismus sei das ideale Wirtschaftssystem»! Wir sehen dieses gleiche Phänomen in allen Ländern. Auch in der Schweiz. Diese neue Schicht hat teils bewusst, mehrheitlich halb- oder sogar unbewusst Schlüsse gezogen aus dem dramatischen Zustand der Welt und dem Scheitern der reformistischen «weichen» Linken in der Lösung der grossen Fragen unserer Zeit: Sie suchen nach einer «harten» Linken mit Klassenkampf und Revolution.
Die «Permakrise» des Kapitalismus aus drohendem Klimakollaps, Aufrüstung und Kriegen, Rassismus und Sexismus, Trump und Rechtspopulisten – das alles hat heftige Auswirkung auf die Psyche der Jugend. Viele fühlen sich von allen Parteien und Organisationen im Stich gelassen. Letztes Jahr kam die einschneidende Erfahrung mit Palästina hinzu: Ein Genozid findet statt und die ganzen westlichen Regierungen, Politiker und Medien legitimieren ihn! Wer sich dagegen aussprach, wurde als Terrorismus-Unterstützer und Antisemit mundtot gemacht. Dagegen haben sich Teile der Jugend mobilisiert. Den Höhepunkt bildeten die Besetzungen der Universitäten, die insbesondere in Genf und Lausanne ein grösseres Ausmass annahmen. Studierende demonstrierten friedlich für ein so offensichtlich legitimes Anliegen – und wurden mit der harten Repression der Rektorate, Medien und Staat konfrontiert! Solche Erfahrungen, von denen in der nächsten Zeit nur mehr dazukommen werden, haben bei Teilen der Jugend zu grossem Frust, aber auch einem deutlichen Radikalisierungsschub geführt. Eine wachsende Schicht von Tausenden, Zehntausenden in der Schweiz nähert sich intuitiv den Antworten der Kommunisten an.
Diese Schicht ist die Avantgarde. Sie ist die Speerspitze im allgemeinen Lernprozess der Arbeiterklasse. Für die meisten von ihnen ist die Frage schon heute nicht mehr, ob es eine Revolution zum Sturz des Kapitalismus braucht. Die Frage ist, wie wir dahinkommen. Dafür brauchen sie den Marxismus.
Unsere Internationale (damals International Marxist Tendency) hat die historische Bedeutung dieser objektiven Entwicklung erkannt und konsequent gehandelt: Vor einem Jahr haben wir die Revolutionäre Kommunistische Internationale gegründet und als Schweizer Sektion die Revolutionäre Kommunistische Partei.
Wir entschlossen uns dazu, um dieser atomisierten Schicht unmissverständlich zu zeigen, dass sie nicht alleine ist, dass es bereits organisierte Kommunisten gibt, die sich politisch und organisatorisch scharf abgrenzen von der gescheiterten Linken und die tatsächlich einen Plan haben. Doch das müssen wir ihnen durch überzeugende Antworten beweisen. Die unmittelbare Aufgabe der RKP ist es, für diese Schicht sichtbar zu werden, so viele von ihnen wie möglich vom aktiven Beitritt zu überzeugen und sie in einer disziplinierten revolutionären Partei zusammenzuschweissen, in der wir sie sorgfältig im Programm, den Perspektiven und den Methoden des Marxismus ausbilden.
Ein Schlüsselelement ist es, ihnen die dialektische Methode und das Verständnis der widersprüchlichen Entwicklung des Bewusstseins beizubringen. Die Avantgarde muss einerseits verstehen, dass sie nur die Speerspitze eines grösseren Prozesses der Radikalisierung ist. Sie muss andererseits verstehen, welche Rolle ihr in diesem Prozess zukommt. Wer erst einmal die Schlussfolgerung gezogen hat, dass es einen radikalen Bruch mit dem ganzen System und allen bestehenden Parteien braucht, kann schnell zur Ungeduld neigen. Das ist verständlich und hat einen positiven Kern. Aber ohne Ausbildung in der marxistischen Methode wird diese Ungeduld zu ernsthaften linksradikalen oder opportunistischen Fehlern führen. Solche würden es unmöglich machen, die Partei nachhaltig aufzubauen und im längeren Prozess die Massen zu gewinnen.
Wir müssen verstehen: Was für Kommunisten klar ist, ist nicht notwendigerweise auch für die breiteren Massen klar. Einige Schichten der Arbeiterklasse haben noch Illusionen in die SP und die Reformierbarkeit des Kapitalismus. Andere wenden sich in ihrer Ablehnung des Status Quo der SVP zu. Weitere sind noch «apolitisch». Wer sich von diesen Schichten deshalb einfach sektiererisch abwendet, wird niemals fähig sein, die Massen für die Revolution zu gewinnen. Die Arbeiter werden ihre Illusionen durch ihre Erfahrungen verlieren. Die meisten von ihnen können wir heute noch nicht für die revolutionäre Partei gewinnen. Mit einer korrekten Übergangsmethode werden wir sie morgen oder übermorgen gewinnen können.
Wir grenzen uns klar vom Reformismus der SP und der kleinbürgerlichen Linken ab. Aber wir dürfen die Debatten innerhalb der reformistischen Linken nicht einfach pauschal verwerfen. Wo die reformistische Linke für echte Verbesserungen einsteht, setzen wir am positiven Kern an und zeigen geduldig, genossenschaftlich, aber scharf auf, inwiefern Reformen nicht ohne die Methoden des Klassenkampfes und letztlich dem Bruch mit Kapitalismus erreicht werden können. Die Methoden, die erlauben, Arbeiter der SVP von der Partei wegzubrechen, haben wir bereits weiter oben ausgeführt.
Die korrekte Methode, um am Bewusstsein der Massen anzusetzen, ist nicht nur eine Frage der Gewinnung der Massen in der Zukunft. Es ist eine Frage der Ausbildung der Kommunisten heute: Mit oberflächlichem Radikalismus werden wir neu rekrutierte Kommunisten nicht halten oder gar nicht erst gewinnen können. Sie brauchen einen überzeugenden Weg zum Kommunismus, sie brauchen die dialektische Methode und die bolschewistische Strategie.
Aus der gleichen Ungeduld kann auch der umgekehrte Fehler entstehen: die Suche nach einem schnelleren Weg zu den Massen. Doch wenn wir versuchen, schneller breitere Massen zu erreichen, indem wir opportunistisch unser Programm und unsere Ideen verwässern, dann geben wir haargenau das auf, was für die Lösung der Krise der Menschheit heute fehlt. Wir müssen einen Sinn für Proportionen behalten. Die RKP ist heute noch eine kleine Kraft. Die meisten Arbeiter interessieren sich nicht für eine kleine Organisation. Es gibt keine Abkürzung. Der Weg zu den Massen läuft über die Organisierung der Avantgarde und ihre geduldige Ausbildung zu marxistischen Kadern.
Damit schaffen wir heute das Gerüst für eine zukünftige kommunistische Massenpartei. Hinter der Avantgarde lauern die nächsten, viel grösseren Schichten des Proletariats. Unter den Erfahrungen der Krise des Kapitalismus werden auch sie offen für die Ideen des Kommunismus. Aber ob wir dann in der Position sein werden, sie zu erreichen, ist einzig und alleine davon abhängig, ob wir heute die vorderste Schicht organisieren und ausbilden. Mit jedem zusätzlichen Kommunisten, den wir heute organisieren und im Marxismus ausbilden, werden wir auf den nächsten Stufen des Klassenkampfes 10, dann 100 neue Arbeiter gewinnen können. Das ist der einzige Weg vorwärts zu einer echten revolutionären Massenpartei.
Um diese Schicht zu organisieren, muss die RKP da präsent sein, wo die Jugend im Alltag ist und sich politisch zu bewegen beginnt. Das Vakuum an echten Antworten auf die Krise der Menschheit ist in der Jugend riesig. Doch wie überall, wo der Klassenkampf über längere Zeit auf tiefem Niveau war, füllen kleinbürgerliche Ideen teilweise das Vakuum. Insbesondere die linke Jugend- und Aktivistenszene wurde über die letzten Jahre komplett von den postmodernen, idealistischen Ansätzen der Identitätspolitik dominiert. Diese Ideen verorten die Wurzel der Unterdrückung in der subjektiven Erfahrung, anstatt in der Klassengesellschaft. Wir haben dagegen konsistent eine kommunistische Herangehensweise an die Frage der Befreiung von allen Formen der Unterdrückung verteidigt, basierend auf der Einheit und dem gemeinsamen objektiven Interesse der gesamten Arbeiterklasse gegen die Kapitalisten. Nur die Überwindung des Kapitalismus in einem revolutionären Prozess wird die materielle Grundlage für das Ende der Unterdrückung schaffen. Dafür wurden und werden wir von linken Kreisen hart angefeindet.
Aber über kurz oder lang werden Ideen in der Praxis getestet. Ideen, die nicht mit der objektiven Realität übereinstimmen, keine Antworten und keine Lösungen für die Probleme der Unterdrückten bieten, verlieren an Anziehungskraft. Mit den USA an der Spitze sehen wir einen internationalen Ablösungsprozess von den «woken» Ideen der Identitätspolitik, die in den vorherigen Jahrzehnten zur dominierenden Ideologie des herrschenden Establishments – und der Linken – geworden sind. Die Ablehnung dieser Ideen (z. B. Quoten, Repräsentation, «gendergerechte» Sprache…) ist positiv, denn sie sind direkt gegen das einzige effektive Mittel im Kampf gegen Unterdrückung gerichtet: den Klassenkampf. Natürlich bieten Demagogen wie Trump keine Alternative. Aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben vielen die Augen geöffnet, dass diese «progressiven» Ideen in Wahrheit nur bürgerlich-liberale Ideen der herrschenden Klasse sind, um ihre Klassenherrschaft zu verschleiern und die Arbeiterklasse zu spalten. In der Schweiz hinkt diese Entwicklung noch hinterher. Aber zweifellos hat auch hier ein Ablösungsprozess begonnen.
In der Folge wird sich ein Teil der linken Szene noch härter in ihren falschen Ideen verbuddeln, sich weiter vom Bewusstsein der Arbeiterklasse isolieren und dadurch nur umso verzweifelter und giftiger gegen alle schiessen, die nicht ihre Meinung teilen. Aber wachsende Teile der Jugend – auch Teile, die vormals von postmodernen Ideen beeinflusst wurden und die Kommunisten offen angefeindet haben – verlieren ihre Illusionen. Symbolpolitik und eine Szene, für die Links-Sein ein Lifestyle ist, ist zunehmend unbefriedigend im Angesicht der dramatischen Entwicklung der Welt.
Wir dürfen keinen Millimeter Zugeständnisse an die kleinbürgerlichen Ideen machen. Wir grenzen uns scharf von ihrer «Szene» und ihren Methoden ab. Gleichzeitig müssen wir im Umgang offen, genossenschaftlich und nicht sektiererisch sein. Wir stehen für die breitestmögliche Mobilisierung und Einheit im Kampf. Wir lehnen jede Isolierung auf Kleinkreise und jede Spaltung von Bewegungen der Unterdrückten ab. Wenn wir angefeindet werden, bleiben wird geduldig und erklären unsere Position. Die objektive Entwicklung arbeitet in unsere Richtung. Wer heute nicht offen oder sogar feindlich ist, wird es morgen oder übermorgen sein, getrieben von den eigenen Erfahrungen.
Alle Bewegungen der letzten Jahre wurden durch die Vorherrschaft von kleinbürgerlichen Ideen in die Sackgasse geführt. Es gibt dadurch eine gewisse Demoralisierung. Doch gibt es einen starken Durst nach echten Erklärungen für die Weltlage und nach echten Antworten. Die Grenzen von kleinbürgerlichen Ein-Themen-Ansätzen, die sich nicht auf die Arbeiterklasse stützen, werden immer offensichtlicher. Was eine breite Schicht sucht, ist eine höhere, umfassendere Form des Kampfes und einen echten Plan, wie man gegen alle die grossen Probleme der Menschheit kämpfen kann. Was sie suchen ist eine revolutionäre Partei mit einem marxistischen Verständnis.
Die RKP ist heute noch klein. Aber die objektive Situation arbeitet in unsere Richtung und wir sind in der besten Ausgangsposition, um in der Jugend zum Referenzpunkt zu werden. Mit jedem neuen Hammerschlag, jeder scharfen Wendung, jeder Erfahrung werden neue Schichten der Jugend zur radikalen Ablehnung des Kapitalismus getrieben und offener für den Kommunismus. Das ist ein Element in der objektiven Situation, das in Zukunft nicht verschwinden wird. Es liegt an uns, alles dafür zu tun, ihnen die Partei zu geben, die sie brauchen und suchen.
Wir haben eine grosse Aufgabe vor uns. Die heutigen dramatischen Krisen und Erschütterungen sind gleichzeitig die Todesqualen eines kapitalistischen Systems im endgültigen Niedergang und die Geburtswehen einer neuen, höheren Gesellschaftsform. Es gibt keinen Mittelweg mehr. Entweder gibt die Arbeiterklasse der Klassenherrschaft der Kapitalisten den Todesstoss – oder sie wird uns mit sich in den Niedergang reissen.
Nur durch den Sturz der Kapitalistenklasse in der proletarischen Revolution, die die Banken und Konzerne enteignet und ins kollektive Eigentum der gesamten Gesellschaft überführt, wird die Menschheit die absurde Irrationalität beenden können, die die Welt heute in Elend und Krieg stürzt, obwohl der gesellschaftliche Reichtum niemals grösser, das Wissen und die Fähigkeiten seiner Menschen niemals umfassender waren. Das Potenzial dafür ist gigantisch.
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird die Arbeiterklasse in allen Ländern, auch in der Schweiz, in Situationen kommen, wo sie auf der Grundlage der Massenmobilisierung die Macht ergreifen kann. Der Klassenkampf hat seine eigenen objektiven Gesetzmässigkeiten, die wir nicht beeinflussen können. Was wir beeinflussen können, ist, in welchem Zustand die revolutionäre Partei sein wird, wenn grössere Erschütterungen die Massen in den Kampf treiben.
Werden wir die kritische Grösse haben, um das kommunistische Programm in die Kämpfe tragen zu können? Werden wir genug ausgebildete marxistische Kader haben, um dem immensen Druck der bürgerlichen Hetze standzuhalten und die nächsten Schritte im Kampf aufzeigen zu können?
Das hängt von uns ab! Ob wir dann 200 oder ob wir 1000, 2000, 5000 ausgebildete Kommunisten sein werden, wird einen riesigen Unterschied machen! Die Bedingungen für den Aufbau der kommunistischen Partei waren seit Jahrzehnten nie besser.
Europa — von Andreas Nørgård, RKI Dänemark — 19. 01. 2026
Schweiz — von RKP Schweiz — 14. 01. 2026
Nah-Ost — von Kommunisten im Iran — 13. 01. 2026
Theorie — von Internationales Sekretariat der RKI — 08. 01. 2026
Lateinamerika — von Revolutionäre Kommunistische Internationale — 03. 01. 2026